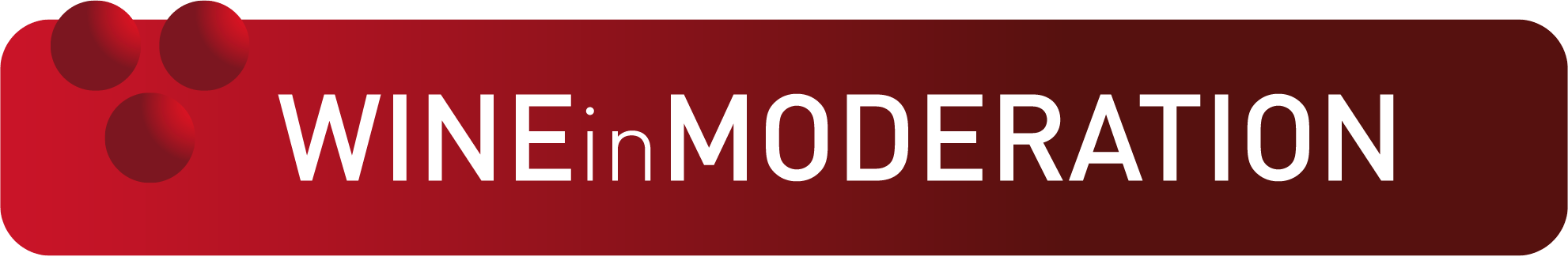|
Nr. 7 |
Arntz, Helmut: Festrede für Dr. Dr. Karl Christoffel und Rudi vom Endt. 1961. 10 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Variatio delectat. Ansprachen bei verschiedenen Gelegenheiten. 1979. 31 Seiten. |
€ 3,50 |
|
|
Nr. 50 |
Schumann, Fritz: Der Weinbaufachmann Johann Philipp Bronner und seine Zeit. 1979. 43 Seiten. |
€ 8,50 |
|
Nr. 54 |
Breider, Hans: Sebastian Englerth. Ein Beitrag zur Geschichte des fränkischen Weinbaues. 1980. 40 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Nr. 78 |
Schellenberg, Kurt; Kreiskott, Horst; Schumann, Fritz; Linsenmaier, Otto: |
€ 9,00 |
| Nr. 100 | Claus, Paul, und Mitarbeiter: Persönlichkeiten der Weinkultur. Kurz-Biographien aus 16 Jahrhunderten. 1991. 132 Seiten. Internetversion |
vergriffen |
|
Nr. 113 |
• Biadene, Giovanni; Pruns, Herbert: Demetrio Zaccaria und seine Biblioteca Internazionale "La Vigna". 1995. S. 1-32. |
€ 7,00 |
|
Nr. 120 |
Hachenberger, Richard: Theodor Heuss, Stationen beim Wein. 1997. 80 Seiten. |
€ 12,00 |
|
Nr. 137 |
Schruft, Günter: Gartendirektor Johann Metzger (1789-1852) und der Weinbau. 2001. 68 Seiten. |
€ 8,00 |
|
Nr. 138 |
Schöffling, Harald: Pioniere der Klonzüchtung bei Weinreben in Deutschland (1876-2001). 2001. 108 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 140 |
Claus, Paul, und Mitarbeiter: Persönlichkeiten der Weinkultur. Kurz-Biographien aus 16 Jahrhunderten. 2., erweiterte Auflage 2002, mit Ergänzungen 2005 und 2009 |
vergriffen |
| Nr. 161 | Schrenk, Christhard: Theodor Heuss – Gedanken über einen ungewöhnlichen Deutschen. 2008. 29 S. |
€ 6,00 |
|
Lidy, Tanja; Suchy, Adolf: Weinbauwissenschaftler mit pharmazeutischen Wurzeln: Benedikt Kölges (1774-1850) und Johann Philipp Bronner (1792-1864). 2016. 112 Seiten. |
€ 11,50 |
|
|
Gros, Leo: Carl Remigius Fresenius (1818–1897) und sein Laboratorium. 2018. 144 Seiten. |
€ 13,00 |
|
|
|
||
|
Prößler, Helmut: Geheimer Kommerzienrat Julius Wegeler, Präsident des deutschen Weinbau-Vereins 1893-1905. 1987. 70 Seiten. |
€ 10,00 |
|
|
Sonderdruck |
Nickenig, Rudolf: Persönlichkeiten der Weinkultur aus Rheinland-Nassau, 2022. 141 Seiten mit s/w und farbigen Abbildungen. |
€ 14,00 |
|
Nr. 9 |
Zimmermann, Eduard: Wein als Erlebnis. 1962. 8 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 12 |
Arntz, Helmut: Der Wein und die Massengesellschaft. 1964. 12 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 25 |
Christoffel, Karl: Der Moselwein in Geschichte und Dichtung. 1971. 24 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 44 |
Fill, Karl: Dichter schmecken Wein. 1977. 25 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 47 |
Variatio delectat. Ansprachen bei verschiedenen Gelegenheiten. 1979. 31 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 64 |
Christoffel, Karl: Bacchus, der Freund des Eros. 1983. 31 Seiten. |
€ 6,50 |
|
Nr. 76 |
Ossendorf, Karlheinz: Schutzpatrone der Winzer. 1986. 84 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 86 |
Gracher, Rosemarie: Wein zur Speise, Wein in der Speise. 1988. 24 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 88 |
Graff-Höfgen, Gisela: Traubenmotive auf Gebrauchstextilien. 1988. 80 Seiten. |
€ 9,00 |
|
Nr. 90 |
Claus, Paul: Weinmuseen im deutschsprachigen Raum. 1989. 35 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Pruns, Herbert; Staab, Josef: Brot und Wein. 1990. 44 Seiten. |
€ 5,00 |
|
|
• Blomberg, Georg Frhr. von: Wein auf Briefmarken. 1991. S. 5-22 mit farbigen Abb. |
€ 12,00 |
|
|
Nr. 101 |
Seeliger, Hans Reinhard: Wein, Mönch und Etikett. 1991. 80 Seiten. |
€ 15,00 |
|
Nr. 105 |
Mathy, Helmut: Weinkultur in Mainz seit dem Mittelalter. 1993. 28 Seiten. |
€ 5,00 |
|
Nr. 126 |
Horn, Günter: Und er trinke den Wein ... |
€ 6,00 |
|
Nr. 134 |
Graff-Höfgen, Gisela: Die Kundschafter des Weines. Das Traubenträgermotiv vom Alten Testament bis heute. 2000. 48 Seiten. |
€ 7,00 |
| Lehmann, Harald; Seidensticker, Peter: Der vollen Brüder Orden. Hieronymus Bocks Weintraktat (um 1540). Eine Weinsatire aus dem 16. Jahrhundert. 2013. 70 Seiten mit s/w Abb. |
€ 12,00 |
|
|
Seeliger, Hans Reinhard: |
€ 10,50 | |
|
Nr. 206 |
Wiesbaden 2023, 79 Seiten mit farbigen Abb.
|
€ 11,00 |
|
Nr. 13 |
Arntz, Helmut: Aus der Geschichte des deutschen Weinhandels. 1964. 24 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 15 |
Zimmermann, Eduard: Wein und Verbraucher. 1966. 8 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 21 |
Koch, Hans-Jörg: Weintrinker und Weingesetz. 1970. 31 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 31 |
Becker, Werner: Möglichkeiten und Hindernisse einer Harmonisierung der Weingesetzgebung im Gemeinsamen Markt. 1973. 22 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 33 |
Baumann, Reinhold: Zwölf Jahrhunderte Weinbau und Weinhandel in Württemberg. 1974. 17 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 47 |
Variatio delectat. Ansprachen bei verschiedenen Gelegenheiten. 1979. 31 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 60 |
Busch, Jörg W.: Der Eberbacher "Cabinetkeller" 1730-1803. 1981. 47 Seiten. |
€ 8,50 |
|
Nr. 71 |
Busch, Jörg W.: Die Anfänge des herzoglich nassauischen Cabinetkellers und der Versuch einer Flaschenvermarktung seiner Weine. 1984. 48 Seiten. |
€ 7,00 |
|
Nr. 77 |
Busch, Jörg W.: Der Rheingauer Weinbau und Handel 1690 bis 1750 am Beispiel der Kellerei Schloß Vollrads. 1986. 64 Seiten. |
€ 9,00 |
|
Nr. 116 |
Ossendorf, Karlheinz: "Sancta Colonia" als Weinhaus der Hanse. |
€ 14,00 |
|
Nr. 118 |
Ossendorf, Karlheinz: "Sancta Colonia" als Weinhaus der Hanse. |
€ 15,00 |
|
Nr. 123 |
Koch, Hans-Jörg - Der Weinlagename als Herkunftsangabe und Qualitätshinweis. Rechtsgeschichte, aktuelle Regelungen, Reformvorschläge. 1998. 36 Seiten. |
€ 5,00 |
|
Nr. 128 |
Göttert, Rolf: Aus der Geschichte des Rüdesheimer Weinhandels. 1999. 32 Seiten. |
€ 5,00 |
|
Nr. 131 |
Koch, Hans-Jörg: Der Wein und die Macher. Weinkultur zwischen Purismus und Fabrikation. 1999. 76 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 136 |
Koch, Hans-Jörg: Wein und Qualität. Markt, Verbrauchererwartung, Weinrecht, Weinbaupolitik. 2001. 25 Seiten. |
€ 5,00 |
|
Hepp, Rowald: Weinrechnungen im Laufe der Zeit. Buchhaltung und Rechnungslegung des Weingutes Schloss Vollrads. 2010. 28 Seiten. |
€ 7,00 |
|
| Koch, Hans-Jörg: Der normierte Weingeschmack. 2012. 24 Seiten. |
€ 5,00 |
|
| Nr. 192 | Seeliger, Hans Reinhard: Châteauneuf-du-Pape und die Entwicklung des modernen französischen Weinrechts. 2017. 44 Seiten. | € 8,50 |
|
Fuchß, Peter: Rudi vom Endt (1892–1966): Maler, Karikaturist, Poet, künstlerischer Gestalter von Weinwerbung und Weinbaulehrschauen. 2017. 96 Seiten. |
€ 12,50 |
|
Claus, Paul: Botrytis Cinerea. Feind und Freund des Winzers. |
€ 4,50 |
|
|
Nr. 4 |
Schanderl, Hugo: Die historische Entwicklung der Gärungswissenschaft. 1960. 8 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 42 |
Staab, Josef: Qualität im Wandel der Zeiten. 1977. 11 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 45 |
Arntz, Helmut: Federweißer. 1977. 20 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 46 |
Hagenow, Gerd: Das Keltern. 1978. 64 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 57 |
Monz, Heinz; Arntz, Helmut: Ludwig Gall - Vom Chaptalisieren. 1981. 32 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Nr. 62 |
Ossendorf, Karlheinz: Schröter, Weinlader, Weinrufer. 1982. 80 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 79 |
Troost, Gerhard: Zur Geschichte der Weinfiltration. 1986. 48 Seiten. |
€ 7,00 |
|
Nr. 97 |
Troost, Gerhard: Die Keltern. Zur Geschichte der Keltertechnik. 1990. 136 Seiten. |
€ 13,00 |
|
Nr. 98 |
Jenemann, Hans R.: Zur Geschichte der Dichtebestimmung von Flüssigkeiten, insbesondere des Traubenmostes in Oechslegraden. 1990. 48 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Nr. 103 |
Eschnauer, Heinz R.: Zur Reinheit des Weines seit 2000 Jahren. Vinum et Plumbum. 1992. 71 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 112 |
Eschnauer, Heinz R.: Feuerwein am Rhein. 1995. 20 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Jakob, Ludwig: Entwicklungen in der Önologie vom Altertum bis zur Neuzeit. 2014. 70 Seiten. |
€ 10,00 |
|
|
Gros, Leo: Carl Remigius Fresenius (1818–1897) und sein Laboratorium. 2018. 144 Seiten. |
€ 13,00 |
|
Nr. 27 |
• Franz, Herbert: Zur Kulturgeschichte des Weinbaus in der Wachau. Vortrag auf der Veranstaltung der Gesellschaft für Geschichte des Weines am 11. September 1971 in Krems. 1972. S. 1-14 mit Abb. |
€ 4,00 |
|
Nr. 35 |
Preuschen, Gerhardt: Arbeitsverfahren und Geräte im Weinbau. 1974. 48 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 58 |
Claus, Paul: Arsen zur Schädlingsbekämpfung im Weinbau 1904-1942. 1981. 39 Seiten. |
€ 7,50 |
|
Nr. 74 |
Claus, Paul: Der Schutz der Reben vor Schädlingen und Krankheiten. 1985. 85 Seiten. |
€ 15,00 |
| Nr. 204 | € 12,00 | |
| Nr. 207 |
Wiesbaden 2024, 120 Seiten mit farbigen Abb.
|
€ 18,50 |
|
Claus, Paul: Botrytis Cinerea. Feind und Freund des Winzers. |
€ 4,50 |
|
|
Preuschen, Gerhardt: Zur Entwicklung der Bodenpflege um den Rebstock. 1994. 32 Seiten. |
€ 7,50 |
|
Nr. 16 |
Arntz, Helmut: Wein im sprachlichen Wettbewerb. 1966. 20 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 26 |
Arntz, Helmut: Natur- und Kulturnamen der Weinlagen des Rheingaus. 1972. 44 Seiten. |
vergriffen |
|
Nr. 37 |
Christoffel, Karl: Die alten Lagennamen der Moselweinberge. 1976. 14 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 48 |
• Fill, Karl: Die Namen der deutschen Weinlagen in alphabetischer Ordnung nach der rückläufigen Buchstabenfolge. 1979. S. 1-35. |
€ 4,00 |
|
Nr. 130 |
Gilles, Karl-Josef: Der Weinlagename "Zeller Schwarze Katz". 1999. 64 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 133 |
Arntz, Helmut: Urkataster und Gewannen. 2000. 192 Seiten. |
€ 22,00 |
|
Prößler, Helmut: Bernkasteler Doctor. Der "kurfürstliche" Weinberg. |
€ 10,00 |
|
Nr. 24 |
Staab, Josef: 500 Jahre Rheingauer Klebrot = Spätburgunder. 1971. 13 Seiten. |
€ 3,50 |
|
• Fill, Karl: Die Namen der deutschen Weinlagen in alphabetischer Ordnung nach der rückläufigen Buchstabenfolge. 1979. S. 1-35. |
€ 4,00 |
|
|
Nr. 61 |
Hoffmann, Kurt M.: Der Gutedel und die Burgunder. 1982. 67 Seiten. |
€ 9,00 |
|
Nr. 63 |
Hoffmann, Kurt M.: Traminer und Muskateller und ihre Weine. 1982. 32 Seiten. |
€ 7,00 |
|
Variatio delectat II. 1983. 48 Seiten mit Abb. |
€ 8,50 |
|
|
Nr. 73 |
Schenk, Walter; Hoffmann, Kurt M.: Zur Familie der Burgunder. 1100 Jahre Blauer Spätburgunder in Bodman am Bodensee. 1985. 40 Seiten. |
€ 6,50 |
|
Nr. 92 |
Linsenmaier, Otto: Der Trollinger und seine Verwandten. 1989. 113 Seiten. |
€ 12,00 |
|
• Blomberg, Georg Frhr. von: Wein auf Briefmarken. 1991. S. 5-22 mit farbigen Abb. |
€ 12,00 |
|
|
Nr. 113 |
• Biadene, Giovanni; Pruns, Herbert: Demetrio Zaccaria und seine Biblioteca Internazionale "La Vigna". 1995. S. 1-32. |
€ 7,00 |
|
Graff-Höfgen, Gisela: Vom Ruländer zum Grauburgunder. Der Wein der Grauen Mönche. 2007. 48 Seiten. |
€ 7,00 |
|
|
Töpfer, Reinhard; Maul, Erika; Eibach, Rudolf: Geschichte und Entwicklung der Rebenzüchtung auf dem Geilweilerhof. 2011. 24 Seiten. |
€ 6,00 |
|
|
Seeliger, Hans Reinhard: Wein und Weinbau der Abtei Ebrach im Steigerwald und die Frage der Herkunft des Silvaners in Franken. 2014. S. 7-25. |
€ 10,50 |
|
|
Maran, Ivo; Morandell, Stefan: Vernatscher, Traminer, Kalterersee Wein. Neues aus Südtirols Weingeschichte. 2015. 83 Seiten. |
€ 10,50 |
|
Nr. 5 |
Schneider, Carl: Zur Bedeutung des Weines in der Antike. 1961. 8 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 6 |
Christoffel, Karl: Der antike Weingott und das Mysterium des Weines. 1961. 11 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 53 |
Heine, Peter: Wein im islamischen Mittelalter. 1980. 32 Seiten. |
€ 9,50 |
|
Nr. 55 |
Ossendorf, Karlheinz: 6000 Jahre Weinbau in Ägypten. 1980. 56 Seiten. |
€ 8,00 |
|
Nr. 102 |
Berger, Michael: Weinhandel und Weinrecht im alten Rom. 1992. 11 Seiten. |
€ 3,00 |
|
Nr. 106 |
Rozumek-Fechtig, Ottraud: Die Grafen von Katzenelnbogen. Weinbau und Weinverzehr im 14. und 15. Jahrhundert. 1993. 59 Seiten. |
€ 12,00 |
|
Nr. 115 |
Gilles, Karl-Josef; König, Margarethe; Schumann, Fritz; Martin-Kilcher, Stefanie; Hanel, Norbert: Neuere Forschungen zum römischen Weinbau an Mosel und Rhein. 1995. 109 Seiten. |
€ 14,00 |
|
Nr. 135 |
Wagner, Frank: Der Weinhaushalt der Landsburg im 15. Jahrhundert. 2000. 68 Seiten. |
€ 8,00 |
|
Nr. 150 |
Schnurrer, Ludwig: Weinbau und Weinkonsum im Spital der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber im späten Mittelalter. 2005. 57 Seiten. |
€ 7,50 |
| Nr. 202 |
Seeliger, Hans Reinhard: Karl der Große und die Straußwirtschaften – ein historisches Missverständnis. Zur Interpretation von Capitulare de villis cap. XXII |
€ 12,00 |
§ 1 Sitz und Zweck
(1) Die Gesellschaft wurde am 16. Januar 1959 gegründet und führt den Namen "Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V.". Sitz der Gesellschaft ist Wiesbaden. Die Gesellschaft ist in das Vereinsregister eingetragen.
(2) Zweck der Gesellschaft ist,
a) die Erforschung der Geschichte des Weines unmittelbar zu fördern;
b) das allgemeine historische Bewusstsein zu vertiefen.
Sie hat das Bestreben, Freunde des Weines und Kenner der kulturgeschichtlichen Zusammenhänge zu vereinen. Im Zusammenwirken mit Behörden, den Versuchs- und Lehranstalten für Weinbau, den Bibliotheken, Archiven, Museen und Fachverlagen und in freundschaftlicher Verbundenheit mit den Verbänden des Weinbaus, des Weinhandels, der Schaumweinkellereien und Weinbrennereien führt sie ein strenges wissenschaftliches Programm durch. Sie will einen Beitrag dazu leisten, dass die Weinkultur wieder ein selbstverständlicher Bestandteil des Kulturlebens unserer Zeit wird.
(3) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Ihre Mitglieder erhalten in dieser Eigenschaft keine Gewinnanteile oder Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Auch darf keine andere Person durch Verwaltungsausgaben oder andere Zuwendungen, die den Zwecken der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen in irgendeiner Form begünstigt werden.
(4) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§ 2 Mitgliedschaft
(1) Mitglied der Gesellschaft kann jede natürliche oder juristische Person werden, die bereit ist, die Bestrebungen der Gesellschaft zu unterstützen.
(2) Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vorstand.
(3) Zu Ehrenmitgliedern können Persönlichkeiten ernannt werden, die sich um die Gesellschaft oder ihre Ziele besondere Verdienste erworben haben. Vorschläge sind an den Vorstand zu richten, der darüber entscheidet und nach Bestätigung durch die Mitgliederversammlung die Ernennung vollzieht.
(4) Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Tod oder Auflösung einer juristischen Gesellschaft;
b) durch Streichung auf Beschluss des Vorstandes bei einem Beitragsrückstand von mindestens zwei Jahren, wobei dadurch nicht die Pflicht zur Zahlung der rückständigen Beiträge entfällt;
c) durch Erklärung des Austritts an den Vorstand mit Vierteljahresfrist zum Ende des Kalenderjahres;
d) durch Ausschluss. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann der Vorstand den Ausschluss eines Mitgliedes beschließen. Der Beschluss ist dem Mitglied mit Begründung zuzustellen. Diesem steht innerhalb von 14 Tagen die Beschwerde an die Mitgliederversammlung zu. Sie ist bei dem/der Präsidenten/-in einzureichen und von diesem der nächsten Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorzulegen.
(5) Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, dessen Höhe durch die Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Alle Beiträge sind zu Jahresbeginn fällig und müssen bis zum 30. Juni des laufenden Jahres entrichtet sein. Die Mitgliederversammlung kann für die Überschreitung dieses Termins einen Säumniszuschlag festsetzen. Für neu eintretende Mitglieder ist die Frist bis zum Jahresende verlängert.
§ 3 Geschäftsjahr
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 4 Organe der Gesellschaft
(1) Die Organe der Gesellschaft sind:
a) der Vorstand;
b) der Wissenschaftliche Beirat;
c) die Mitgliederversammlung.
(2) Die Gesellschaft wird im Sinne des § 26 BGB durch den/die Präsidenten/-in oder durch den/die Vizepräsidenten/-in oder durch den/die Geschäftsführer/-in vertreten.
§ 5 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:
a) dem/der Präsidenten/-in;
b) dem/der Vizepräsidenten/-in;
c) dem/der Geschäftsführer/-in;
d) dem/der Schatzmeister/-in;
e) dem/der Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats;
f) zwei weiteren Mitgliedern.
(2) Die Mitgliederversammlung wählt:
a) den/die Präsidenten/-in auf fünf Jahre;
b) den/die Geschäftsführer/-in und den/die Schatzmeister/-in auf vier Jahre;
c) den/die Vizepräsidenten/-in und zwei weitere Mitglieder auf drei Jahre.
Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl kann in einem Wahlgang erfolgen. Auf Antrag erfolgt sie in geheimer Abstimmung.
(3) Der/die Geschäftsführer/-in hat nach den Beschlüssen des Vorstandes die Geschäfte zu führen. Er/Sie hat den/die Präsidenten/-in laufend, den übrigen Vorstand und den Beirat auf Verlangen über die Geschäftsvorgänge zu unterrichten. Er/Sie hat das Protokoll der Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen zu führen.
(4) Der/Die Schatzmeister/-in erledigt die laufenden Zahlungen selbstständig; für außergewöhnliche bedarf er/sie der Anweisung des/der Präsidenten/-in. Er/Sie ist bevollmächtigt, über die Geldkonten der Gesellschaft zu verfügen. Die Rechnungslegung muss bis zur Mitgliederversammlung im Folgejahr erfolgt sein. Über die Entlastung entscheidet die Mitgliederversammlung auf Antrag von zwei Rechnungsprüfern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden.
(5) Nach Ablauf ihrer Amtsperiode bleiben der/die Präsident/-in und der/die Vizepräsident/-in bis zur Wahl der Nachfolger kommissarisch im Amt.
(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus, können die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur Durchführung von Neuwahlen ein Ersatzmitglied berufen.
§ 5a Vergütung
(1) Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Sie können eine Aufwandsentschädigung erhalten und einen angemessenen Ersatz ihrer Auslagen.
(2) Dem/Der Geschäftsführer/-in kann eine angemessene Vergütung bezahlt werden.
§ 6 Wissenschaftlicher Beirat
(1) Der Wissenschaftliche Beirat hat den Vorstand zu beraten und ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Im besonderen obliegt ihm die Förderung und kritische Begutachtung der wissenschaftlichen Vorhaben. Damit trägt er wesentliche Verantwortung für die Erfüllung des Zwecks der Gesellschaft gemäß § 1.
(2) Dem Beirat gehören eine unbeschränkte Zahl von Mitgliedern an. Sie werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Mitglieder können entsprechende Vorschläge an den Vorstand richten. Wiederwahl ist zulässig.
(3) Der Wissenschaftliche Beirat wählt alle drei Jahre aus seiner Mitte den/die Vorsitzende/-n.
(4) Beschlüsse des Wissenschaftlichen Beirates werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Sie sind in einem Protokoll festzuhalten, das allen Beiratsmitgliedern und allen Vorstandsmitgliedern innerhalb eines Monats zuzusenden ist. Das Protokoll ist von dem/der Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirates zu unterzeichnen.
(5) Der/Die Präsident/-n ist zur Teilnahme an den Beiratssitzungen einzuladen.
§ 7 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr schriftlich durch den/die Geschäftsführer/-in unter Angabe der Tagesordnung mit vierwöchiger Frist einzuberufen. Auf Antrag des Wissenschaftlichen Beirates oder von mindestens einem Fünftel der Mitglieder hat der/die Geschäftsführer/-in eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig (Ausnahme § 9,2). Sie beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit (Ausnahme § 7,3 k).
(3) Die Mitgliederversammlung ist u.a. zuständig für:
a) Entgegennahme des Geschäftsberichtes;
b) Genehmigung der Jahresrechnung;
c) Entlastung des Vorstandes und des/der Schatzmeisters/-in (§ 5,4);
d) Wahl von Vorstandsmitgliedern (§ 5,2);
e) Wahl der Rechnungsprüfer (§ 5,4);
f) Wahl von Beiratsmitgliedern (§ 6,2);
g) Bestätigung von Ehrenmitgliedern (§ 2,3);
h) Festsetzung des Jahresbeitrags (§ 2,5);
i) Entscheidung über Beschwerden (§ 2,4d);
k) Änderungen der Satzung. Sie müssen mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden und die Einladung muss den Tagesordnungspunkt "Satzungsänderung" enthalten haben.
l) Auflösung der Gesellschaft (§ 9).
(4) Das Protokoll der Mitgliederversammlung führt der/die Geschäftsführer/-in. Es ist von dem/der Präsidenten/-in, dem/der Geschäftsführer/-in und dem/der Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirates zu unterzeichnen.
§ 8 Arbeitsgruppen
(1) Zur Bearbeitung fachlich abgegrenzter wissenschaftlicher Probleme können durch den Beirat Arbeitsgruppen gebildet werden.
(2) Die Obmänner der Arbeitsgruppen werden vom Beirat ernannt und abberufen. Sie müssen Mitglieder der Gesellschaft sein.
(3) Die Zahl der Mitglieder einer Arbeitsgruppe ist nicht begrenzt. Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe bestimmt ihr Obmann. Es können auch Nichtmitglieder zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe gebeten werden.
(4) Ist der Beirat der Auffassung, dass eine Arbeitsgruppe ihre Aufgaben gelöst hat oder in angemessener Zeit nicht erfüllen kann, so kann er die Arbeitsgruppe auflösen.
§ 9 Auflösung der Gesellschaft
(1) Die Auflösung der Gesellschaft kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.
(2) Bei dieser Mitgliederversammlung müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sein. Zum Beschluss der Auflösung ist die Zustimmung von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich.
(3) Ist die Mitgliederversammlung beschlussunfähig, so entscheidet nach nochmaliger Einberufung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(4) Bei Auflösung der Gesellschaft oder Wegfall ihres bisherigen Zweckes fällt das Vermögen an das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit der Maßgabe, die Mittel der weinkundlichen Forschung zur Verfügung zu stellen. Die Bibliothek und die Sammlungen sollen als jeweils geschlossene Einheit erhalten bleiben und von dem Institut verwaltet werden, das in der Lage ist, dieselben sowohl den Studierenden als auch der Forschung nutzbar zu machen.
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 7. Februar 1961 beschlossen und durch Beschlüsse vom 11. April 1964, 30. April 1966, 23. April 1977, 17. April 1982, 17. März 1984, 20. April 1995, 19. April 2008, 24. April 2010 und 21. April 2018 geändert.
Prof. Dr. Hans Reinhard Seeliger, Präsident
Dr. Gerhard Stumm, Protokollant
Eduard Merkle, Geschäftsführer
Mitglied werden – Gemeinsam Weingeschichte entdecken
|
Sie interessieren sich für Wein, seine Geschichte und seine kulturellen Hintergründe? Alle Weinfreund*innen, die ihr Wissen rund um den Wein vertiefen möchten, sind herzlich eingeladen, Mitglied der Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. zu werden. Auch wer sich aktiv an unseren Forschungen beteiligen möchte, ist bei uns willkommen – denn die Geschichte des Weines birgt noch viele spannende Facetten, die es zu entdecken gilt. Beruflich mit Wein befasst? Dann profitieren Sie von unserem Netzwerk: Die GGW bietet Ihnen eine nahezu unverzichtbare Plattform für fachlichen Austausch, historische Einordnung und wissenschaftliche Diskussion. Auch deshalb lohnt es sich, Mitglied unserer Gesellschaft zu werden: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schauen Sie sich doch unsere Schriftenreihe an.
|
Machen Sie mit – wir freuen uns auf Sie! Jetzt informieren & beitreten: Wenn Sie Mitglied werden möchten, so füllen Sie ganz einfach hier online das Formular aus. Gerne können Sie uns Ihren Beitrittswunsch auch per E-Mail an *Mitgliedsbeiträge Die Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. erhebt seit 2019 folgende jährliche Mitgliedsbeiträge:
Patenmitgliedschaft (für 2 Jahre):
|
*Die Mitgliedsbeiträge werden zu Beginn des Jahres fällig und von der Gesellschaft per Lastschriftverfahren eingezogen. Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie das Formular zur Einzugsermächtigung vorab downloaden, ausfüllen und Ihrem Antrag beifügen. Sie können uns das ausgefüllte und eingescannte Formular auch per E-mail oder per Post zuschicken.
Während des Jahres aufgenommene Mitglieder zahlen den vollen Jahresmitgliedsbeitrag. Sie erhalten dafür auch die bereits ausgelieferten Mitteilungen und Schriften des laufenden Jahres.
Patenmitgliedschaft verschenken:
Sicherlich haben Sie Verwandte oder Freunde, von denen Sie wissen, dass sich diese auch für die Ziele unserer Gesellschaft interessieren. Dann verschenken Sie doch mal eine – sehr preisgünstige (siehe oben) – Patenmitgliedschaft für zwei Jahre zum Mitgliedsbeitrag von einem Jahr! Patenmitglieder erhalten eine Geschenkurkunde und genießen alle Rechte und Vorteile wie ordentliche Mitglieder.
Wenn Sie also eine Patenmitgliedschaft verschenken wollen, dann können Sie das untenstehende Formulare online ausfüllen, Sie bzw. das Patenmitglied erhalten umgehend Ihre Geschenkurkunde! Laufzeitbeginn ist immer der 1. Januar. Sie können den Mitgliedsbeitrag für die Patenmitgliedschaft bereits vorab unter Angabe des Namens auf unser Konto bei der Nassauischen Sparkasse Wiesbaden überweisen, IBAN: DE83 5105 0015 0100 0173 18, BIC: NASSDE55.
Wenn Sie eine Patenmitgliedschaft verschenken möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: