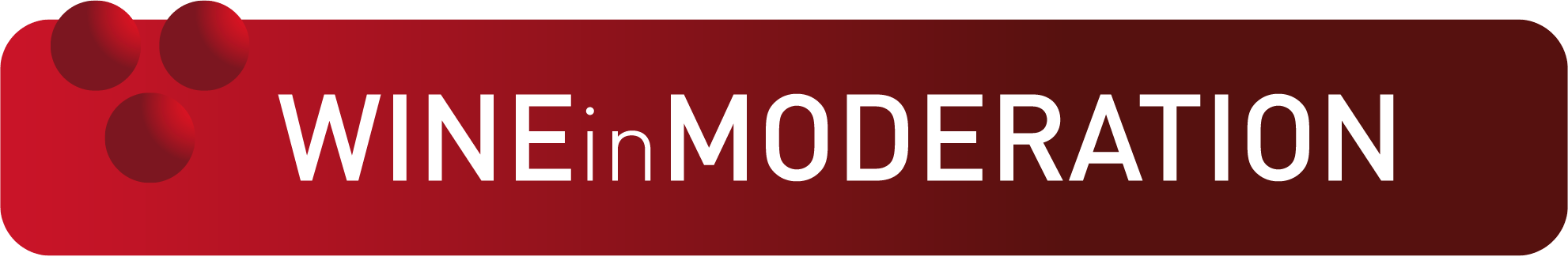• Allgemein
• Baden + Württemberg
• Franken + sonstiges Bayern
• Hessische Bergstraße + Rheingau + sonstiges Hessen
• Nord-Deutschland: Berlin, Brandenburg + Bremen
• Ost-Deutschland: Saale-Unstrut + Sachsen
• Rheinland-Pfalz: Ahr + Mittelrhein + Mosel, Saar, Ruwer + Nahe + Pfalz + Rheinhessen
Allgemein
|
Nr. 207 |
Wiesbaden 2024, 120 Seiten mit farbigen Abb.
|
€ 18,50 |
Ahr
|
Nr. 10 |
Rausch, Jakob: Die Geschichte des Weinbaus an der Ahr.1963. 11 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 67 |
Variatio delectat II. 1983. 48 Seiten mit Abb. |
€ 8,50 |
|
Nr. 146 |
Herborn, Wolfgang: Der Weinbau an der Ahr im frühen und hohen Mittelalter. 2004. 75 Seiten. |
€ 9,00 |
|
Hoffmann, Peter; Hofäcker, Werner; Stumm, Gerhard: Die drei preußischen Staatsdomänen in Rheinland-Pfalz: Trier, Niederhausen-Schloßböckelheim und Marienthal. 2019. 124 Seiten. |
€ 12,00 |
Baden
|
Nr. 14 |
Endriss, Gerhard: Der badische Weinbau in historisch-geographischer Betrachtung. 1965. 27 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 23 |
Spahr, Gebhard: Wein und Weinbau im Bodenseeraum. 1970. 36 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 40 |
Götz, Bruno: Die Geschichte des Weinbaues von Freiburg. 1976. 24 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 73 |
Schenk, Walter; Hoffmann, Kurt M.: Zur Familie der Burgunder. 1100 Jahre Blauer Spätburgunder in Bodman am Bodensee. 1985. 40 Seiten. |
€ 6,50 |
|
Nr. 124 |
Brucker, Philipp / Hachenberger, Richard / Trogus, Heinz: In der Ortenau. 1998. 32 Seiten. |
€ 5,00 |
|
Nr. 160 |
Schruft, Günter: 100 Jahre Naturweinerzeuger und Prädikatsweingüter (VDP) in Baden 1907–2007. 47 Seiten. |
€ 8,50 |
|
Nr. 165 |
Schruft, Günter: Markgräfler Winzer - Die ersten Mitarbeiter von Dr. Adolph Blankenhorn am Oenologischen Institut Karlsruhe. 2009. 88 Seiten. |
€ 11,50 |
|
Schruft, Günter: Die Geschichte der Veredelung des Weinbaus auf Vulkanböden im Kaiserstuhl/Baden. 2015. 151 Seiten. |
€ 16,50 |
|
| Nr. 201 | € 8,00 |
Franken, sonstiges Bayern
|
Nr. 11 |
Breider, Hans: Der fränkische Weinbau in der Landschaft. 1964. 15 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 54 |
Breider, Hans: Sebastian Englerth. Ein Beitrag zur Geschichte des fränkischen Weinbaues. 1980. 40 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Nr. 162 |
• Häußler, Theodor: Der Baierwein einst und heute. 2008. S. 1-40. |
€ 9,00 |
|
Seeliger, Hans Reinhard: |
€ 10,50 |
|
| Nr. 197 |
Weber, Andreas Otto: Die Anfänge der fränkischen Weinkultur – von der Karolingerzeit bis zur ersten Jahrtausendwende. 2019 56 Seiten |
€ 11,00 |
| Nr. 205 |
Wiesbaden 2023, 47 Seiten mit farbigen Abb.
|
€ 9,00 |
Hessische Bergstraße
|
Nr. 29 |
Eichhorn, Ernst: Geschichte und Bedeutung des Weinbaues an der hessischen Bergstraße. 1972. 12 Seiten. |
€ 2,50 |
Mittelrhein
|
Nr. 49 |
Prößler, Helmut: Das Weinbaugebiet Mittelrhein in Geschichte und Gegenwart. 1979. 120 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Nr. 107 |
• Prößler, Helmut: Koblenz 2000 Jahre und der Wein. 1993. S. 5-25. |
€ 6,00 |
|
Nr. 203 |
Nickenig,Rudolf: Weinbauvereine am Mittelrhein von der Aufklärung bis zum Reichsnährstand, 2021. 131 Seiten mit s/w und farbigen Abb. |
€ 12,00 |
Mosel, Saar, Ruwer
|
Nr. 25 |
Christoffel, Karl: Der Moselwein in Geschichte und Dichtung. 1971. 24 Seiten. |
vergriffen |
|
Nr. 107 |
Prößler, Helmut: Koblenz 2000 Jahre und der Wein. 1993. 36 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Nr. 154 |
Frieden, Karl-Heinz: Entwicklung des Weinbaus an der Obermosel. 2006. 28 Seiten. |
€ 6,50 |
|
Nr. 167 |
Schmitt, Roland: Zur Geschichte des Weinbaus im Bliesgau und an der oberen Saar (Saar-Blies-Winkel). 2010. 32 Seiten. |
vergriffen |
|
Hoffmann, Peter; Hofäcker, Werner; Stumm, Gerhard: Die drei preußischen Staatsdomänen in Rheinland-Pfalz: Trier, Niederhausen-Schloßböckelheim und Marienthal. 2019. 124 Seiten. |
€ 12,00 |
Nahe
|
Nr. 148 |
Schmitt, Friedrich: Geschichte des Weinbaus an der Nahe. 2004. 48 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Hoffmann, Peter; Hofäcker, Werner; Stumm, Gerhard: Die drei preußischen Staatsdomänen in Rheinland-Pfalz: Trier, Niederhausen-Schloßböckelheim und Marienthal. 2019. 124 Seiten. |
€ 12,00 |
Pfalz
|
Nr. 67 |
Variatio delectat II. 1983. 48 Seiten mit Abb. |
€ 8,50 |
|
Nr. 169 |
Adams, Karl: Der Herrenhof in Neustadt-Mußbach an der Weinstraße. Fronhof, Johannitergut, Kulturzentrum, ältestes Weingut der Pfalz. 2010. 64 Seiten. |
vergriffen |
|
Bamberger, Udo; Fuchß, Peter; Kissinger, Hans-Günther; Adams, Karl; Hoos, Günter: Geschichte der Domäne Mainz und der Staatsweingüter im südlichen Rheinland-Pfalz. 2016. 160 Seiten. |
€ 16,50 |
Rheingau
|
Nr. 20 |
Kalinke, Helmut: Der Rheingau, Weinkulturzentrum gestern, heute und morgen. 1969. 52 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 22 |
Staab, Josef: Beiträge zur Geschichte des Rheingauer Weinbaus. 1970. 39 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 30 |
Schaefer, Albert: Die alte Rheingauer Freiheit. 1973. 22 Seiten. |
€ 3,50 |
|
Nr. 32 |
Struck, Wolf-Heino: 1000 Jahre Weinbau in Wiesbaden-Schierstein. Zur Geschichte der Weinkultur in urbanisierter Zone am Rande des Rheingaus. 1973. 43 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 52 |
Labonte, Christian Josef: Rheingauer Wein- und Geschichtschronik von 1626 bis 1848. 1979. 105 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 77 |
Busch, Jörg W.: Der Rheingauer Weinbau und Handel 1690 bis 1750 am Beispiel der Kellerei Schloß Vollrads. 1986. 64 S. |
€ 9,00 |
|
Nr. 81 |
Staab, Josef: Die Zisterzienser und der Wein am Beispiel des Klosters Eberbach. 1987. 20 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 121 |
Vorster, Karl Anton v.: Der Rheingauer Weinbau aus selbst-eigener Erfahrung und nach der Naturlehre beschrieben (Faksimiledruck nach dem Original von 1765). 1997. 408 Seiten. |
€ 20,00 |
|
Nr. 142 |
Wagner, Frank: Eltville, die Weinburg des Kurstaates Mainz. 2003. 56 Seiten. |
€ 7,50 |
|
Nr. 166 |
Hepp, Rowald: Weinrechnungen im Laufe der Zeit. Buchhaltung und Rechnungslegung des Weingutes Schloss Vollrads. 2010. 28 S. |
€ 7,00 |
Rheinhessen
|
Nr. 19 |
Koch, Hans-Jörg: Rheinhessen/Weinhessen. Skizzen aus 2000 Jahren. 1969. 8 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 168 |
Jung, Patrick; König, Margarethe: Zur Frage des römischen Weinbaus in Rheinhessen. 2010. 80 Seiten. |
€ 10,50 |
|
Wagner, Andreas (Hrsg.): Weinbau in Rheinhessen. Beiträge des Kulturseminars der Weinbruderschaft Rheinhessen zu St. Katharinen am 14. November 2015. 2016. 115 Seiten. |
€ 10,00 |
|
|
Bamberger, Udo; Fuchß, Peter; Kissinger, Hans-Günther; Adams, Karl; Hoos, Günter: Geschichte der Domäne Mainz und der Staatsweingüter im südlichen Rheinland-Pfalz. 2016. 160 Seiten. |
€ 16,50 |
Saale - Unstrut
|
Nr. 65 |
Bernuth, Jörg: Der Thüringer Weinbau. 1983. 40 Seiten. |
€ 8,50 |
|
Nr. 85 |
Bernuth, Jörg: Der Jenaer Weinbau. 1988. 64 Seiten. |
€ 8,00 |
|
Nr. 132 |
Peukert, Jörg: Der Freyburger Weinbau vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. 1999. 84 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Rhein, Stefan: Martin Luther und der Wein. 2012. 44 Seiten. |
vergriffen |
|
|
Sommerfeld, Hubertus: Der Weinbau im Mansfelder Land. 2013. 48 Seiten |
€ 7,50 |
|
|
Hellwig, Beate: Die Vielfalt der Trink- und Schenkgefäße im Lauf der Jahrhunderte. 2014. 56 Seiten über die Sonderausstellung im Museum Schloss Neuenburg in Freyburg (Unstrut). |
€ 10,00 |
Sachsen
|
Nr. 72 |
Bernuth, Jörg: Der Weinbau an der Elbe. 1984. 48 Seiten. |
€ 6,00 |
|
Nr. 125 |
Ulrich, Gerd: Archivalien zur Geschichte des sächsischen Weinbaus 1887-1997 unter besonderer Berücksichtigung des Reblausbefalls 1887. 1998. 55 Seiten. |
€ 9,00 |
|
Nr. 139 |
Ulrich, Gerd: Studie zur Entwicklung der Rebsorten und ihrer Bezeichnungen im Weinbau Sachsens. 2002. 43 Seiten. |
€ 6,50 |
|
Nr. 141 |
Walter, Hannes: Meissener Porzellan und Meißener Wein. 2003. 40 Seiten. |
€ 8,50 |
|
Nr. 143 |
Wagner, Andreas: Wandlungen sächsischer Weinbaupolitik im 19. und 20. Jahrhundert. 2003. 32 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Ulrich, Gerd: Die Sächsische Weinbaugesellschaft. Eine Studie zur Geschichte und Wirkung der Gesellschaft in Sachsen und Deutschland. 2008. 83 Seiten. |
€ 10,50 |
Württemberg
|
Nr. 8 |
Graf Adelmann, Raban: Die Geschichte des württembergischen Weinbaus. 1962. 15 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 33 |
Baumann, Reinhold: Zwölf Jahrhunderte Weinbau und Weinhandel in Württemberg. 1974. 17 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 51 |
Baer, Otto: Werden, Wachsen und Wirken der württembergischen Weingärtnergenossenschaften. 1979. 80 Seiten. |
€ 10,00 |
|
Nr. 127 |
Metzger, Otto: Zum Weinbau im mittleren Taubertal. 1998. 39 Seiten. |
€ 5,00 |
|
Nr. 163 |
Quarthal, Franz: Der Weinbau am oberen Neckar. 2009. 24 Seiten. |
€ 6,00 |
| Nr. 206 |
Wiesbaden 2023, 79 Seiten mit farbigen Abb.
|
€ 11,00 |
Berlin, Brandenburg
|
Prüfer, Lutz H.: Potsdam und der Wein. 2006. 40 Seiten mit Abb. |
€ 8,00 |
|
|
Krätzner, Claus: Zur Geschichte des Weinbaus in der Mark Brandenburg unter besonderer Berücksichtigung der Neumark. 2011. 47 Seiten mit Abb. |
€ 6,00 |
Bremen
|
Nr. 153 |
Kloft, Hans: Bremen und der Wein. Geschichte, Wirtschaft, Poesie. 2006. 28 Seiten mit Abb. |
€ 6,50 |
Sonstiges Hessen
|
Nr. 110 |
May, Hartmut: Weinstadt Dillenburg. Eine kleine Weinchronik über Weintrinken und Weinbau in Dillenburg. 1994. 40 Seiten mit Abb. |
€ 6,00 |
• Allgemein
• Frankreich
• Italien
• Luxemburg
• Österreich
• Schweiz
• Siebenbürgen
Allgemein
|
Nr. 207 |
Wiesbaden 2024, 120 Seiten mit farbigen Abb.
|
€ 18,50 |
Frankreich
|
May, Degenhard: Flacon, Carafon, Bouteille. Zur Geschichte der Weinflasche in Frankreich. 2012. 84 Seiten mit Abb. |
€ 15,00 |
|
|
Seeliger, Hans Reinhard: Châteauneuf-du-Pape und die Entwicklung des modernen französischen Weinrechts. 2017. 44 Seiten. |
€ 8,50 | |
|
Busse, Christian: Weinbau und Weinrecht im Reichsland Elsass-Lothringen. 2020. 120 Seiten. |
€ 13,50 |
Italien
|
Nr. 93 |
Ansprachen und Vorträge anläßlich der Gebietsveranstaltung Südtirol am 17. und 18. Juni 1988 in Bozen und San Michele al Adige. 1989. 55 Seiten. |
€ 5,00 |
|
Hungerbühler, Plazidus; Maran, Ivo; Morandell, Stefan: Der Weinbau im Etschlande von Augustin Nagele, Propst zu Gries (1753–1815). 2015. 187 Seiten. |
€ 15,00 | |
|
Maran, Ivo; Morandell, Stefan: Vernatscher, Traminer, Kalterersee Wein. Neues aus Südtirols Weingeschichte. 2015. 83 Seiten. |
€ 7,00 | |
|
Scartezzini, Helmuth; Zwerger, Roland; Lageder, Alois; Dipoli, Peter: Südtiroler Weinbaugeschichte. Vorträge anlässlich der Jahrestagung 2018 in Südtirol. 2018. 72 Seiten. |
€ 11,50 |
Luxemburg
|
Nr. 41 |
Gerges, Martin: Aus der Geschichte des Luxemburger Weinbaus. 1977. 23 Seiten. |
€ 3,50 |
Österreich
|
• Franz, Herbert: Zur Kulturgeschichte des Weinbaus in der Wachau. Vortrag auf der Veranstaltung der Gesellschaft für Geschichte des Weines am 11. September 1971 in Krems. 1972. S. 1-14 mit Abb. |
€ 4,00 |
Schweiz
|
Nr. 34 |
Bächtold, Kurt: Aus der Geschichte des Weinbaus in der Ostschweiz. 1974. 17 Seiten. |
€ 2,50 |
|
Nr. 36 |
Karlen, Léo: Der Wein im Wallis. 1974. 16 Seiten. |
€ 2,50 |
Siebenbürgen
|
Nr. 108 |
Acker, Hans: Weinland Siebenbürgen. Achthundert Jahre Weinbau im Karpatenbogen. 1993. 132 Seiten. |
€ 17,00 |
{rt}
China
|
Kupfer, Peter: Ursprünge, Überlieferungen und Entwicklungen der Weinkultur und des Weinbaus in China – Eine Entdeckungsreise durch neun Jahrtausende. 2020. 299 Seiten. |
€ 29,00 |
Israel
|
Nr. 43 |
Goor, Asaph: Geschichte des Weines im Heiligen Land. 1977. 22 Seiten. |
€ 2,50 |
Südafrika
|
Nr. 129 |
Ambrosi, Hans;Grünewald, Hildemarie; Graf von Dürckheim, Max: Deutsche im Kapweinbau 1652-1999. 1999. 93 Seiten. |
€ 14,00 |
Die Gründer*innen unserer Gesellschaft haben 1959 in der Satzung das Ziel festgelegt, „Freunde des Weins und Kenner der kulturwissenschaftlichen Zusammenhänge zu vereinen“. Wir organisieren eine Kommunikationsplattform für professionelle Weinhistoriker, Weingeschäftsleute und Weinfreunde, die sich für Weinkultur und -historie interessieren. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kultur und der Geschichte des Weines. Die Ergebnisse werden in einer eigenen Schriftenreihe veröffentlicht, die unsere Mitglieder kostenlos erhalten. Alle Weinliebhaber*innen, die ihr Wissen um den Wein und dessen Kultur und Geschichte vertiefen möchten, können Mitglieder unseres Vereins werden.
Zu unseren wichtigsten Aktivitäten zählen die Herausgabe
- der Schriften zur Weingeschichte (bis zum Jahre 2020: 200 Hefte),
- des biographischen Lexikons Persönlichkeiten der Weinkultur (2. Aufl. 2002, mit laufenden Ergänzungen im Internet),
- der Bibliographie zur Geschichte und Kultur des Weines. Sie ist eine Literaturdokumentation der deutschsprachigen Weinliteratur.
Außerdem unterhält die Gesellschaft eine
- weingeschichtliche Bibliothek (als Abteilung in der Hauptbibliothek der Hochschule Geisenheim: zurzeit ca. 2.000 Bände),
- Sammlung von historischen Münzen mit Weinmotiven (im „Museum für Weinkultur“, Deidesheim),
- Sammlung von Briefmarken mit Weinmotiven,
- Sammlung von historischen Weinetiketten.
Dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirates der Gesellschaft für Geschichte des Weines, Dr. Gerhard Stumm, wurdeim Auftrag des Ministerpräsidenten Kurt Beck von der Umweltministerin Ulrike Höfken in Mainz die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz überreicht. Die Anerkennung erfolgte für sein umfassendes ehrenamtliches Engagement in der katholischen Kirche, der Politik und beim Naturschutz.
Die Gesellschaft gratuliert ihrem Vorstandsmitglied und schließt sich den Worten der Ministerin Höfken an: „Eine derart breit gefächerte und kontinuierliche Arbeit im Ehrenamt ist wirklich außerordentlich und hat Anerkennung verdient“! Dabei wurde die Arbeit von Dr. Stumm für unsere Gesellschaft noch nicht eigens berücksichtigt.
Dem Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Gesellschaft für Geschichte des Weines, Dr. Bernd H.E. Hill, wurde anlässlich der Mitgliederversammlung der Ehrenpreis des Weinbauversuchsrings Pfalz überreicht. In seiner Laudatio hob der Pfälzer Weinbaupräsident Edwin Schrank die Verdienste für die Rebenzüchtung und das Sortenwesen hervor. Insgesamt hat Dr. Hill einen wichtigen Beitrag zum erweiterten Sortenportfolio und zur gestiegenen Bedeutung des Anbaugebietes Pfalz in der Rotweinerzeugung geleistet.
Quelle: Der Deutsche Weinbau. 2013, Nr. 2, Seite 38 mit Foto.
|
Sonderausstellung im Schlossparkmuseum
|
Wein und Sekt in alten FlaschenUnser Mitglied Degenhard May wird im Schlossparkmuseum in Bad Infos zu den Öffnungszeiten des Schlossparkmuseums in Bad Kreuznach |
|
|
|
|
Nr. 56 |
Verzeichnis der Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte des Weines. 1980 |
€ 3,00 |
|
Nr. 69 |
Fill, Karl; Claus, Paul: Fünfundzwanzig Jahre Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. 1984. 56 Seiten. |
€ 4,00 |
|
Nr. 145 |
Claus, Paul: Gesellschaft für Geschichte des Weines. Rückblick 1984-2003. 2004. 98 Seiten. |
€ 6,00 |
| Nr. 164 | Fünfzig Jahre Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. 1959-2009 . 68 Seiten. (Diese Dokumentation kann hier auch als pdf-Datei gelesen werden.) |
€ 7,50 |
|
|
|
|
|
Prof. Dr. Hans-Jörg Koch wurde am 17. Januar 2011 mit der Professor-Niklas-Medaille in Silber ausgezeichnet. Diese höchste Auszeichnung des Bundes-ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde ihm für seine herausragenden Verdienste um die deutsche Weinwirtschaft von Julia Klöckner, Parlamentarische Staatssekretärin im BMELV, verliehen: |
Die Briefmarkensammlung der Gesellschaft für Geschichte des Weines e.V. mit Bezug zum Wein wurde 1996 neu begonnen. Der Auftrag lautete, alle Briefmarken der ganzen Welt, die einen Bezug zum Wein haben, ob postfrisch oder gestempelt, zu sammeln. Nach sechs Jahren wurden etwa 1000 Marken zusammengetragen.
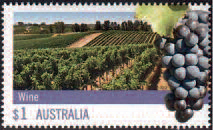
Da jeden Tag neue Marken erscheinen, ist nicht bekannt, wie viele Marken es mit diesen Motiven gibt. Einer Aufstellung eines erfahrenen Sammlers zufolge waren es vor etwa fünf Jahren ungefähr 1500 Marken, welche die verschiedenen Postanstalten der ganzen Welt editiert haben.
Unserer Sammlung fehlen vor allem die Marken aus Übersee, insbesondere aus Afrika und Asien. Diese Marken sind im einschlägigen Fachhandel und bei anderen Sammlerkollegen nur sehr schwer zu beschaffen. Es wird jedoch versucht, alle fehlenden Marken noch zusammenzutragen.
Neben den Briefmarken besitzen wir auch einen kleinen Bestand an Werbemarken vom Beginn des 20. Jahrhunderts.

Informationen zu unserer Sammlung erhalten Sie über
Briefmarkenfreund/in gesucht!
Unsere Gesellschaft sammelt seit den 1960er-Jahren Briefmarken mit Weinmotiven – eine einzigartige, international angelegte Sammlung mit über 1.200 Marken. Nun suchen wir einen engagierten Nachfolger*in für die Betreuung dieser kulturhistorisch wertvollen Sammlung.
Bei Interesse freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen an
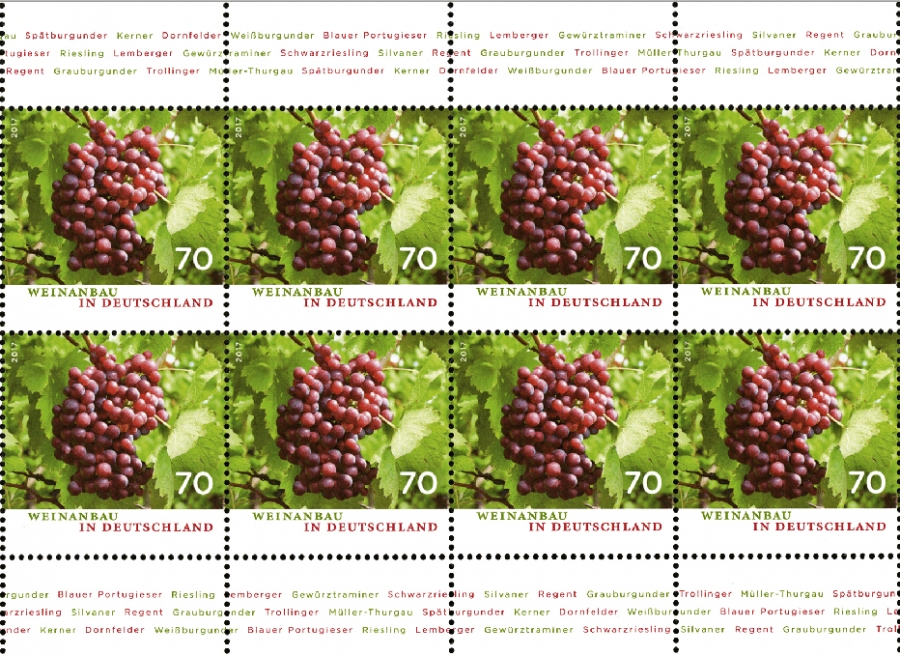
Weinanbau in Deutschland - ab 7.9.2017

Deutschlands schönste Panoramen: Badische Weinstraße - ab 12.10.2017