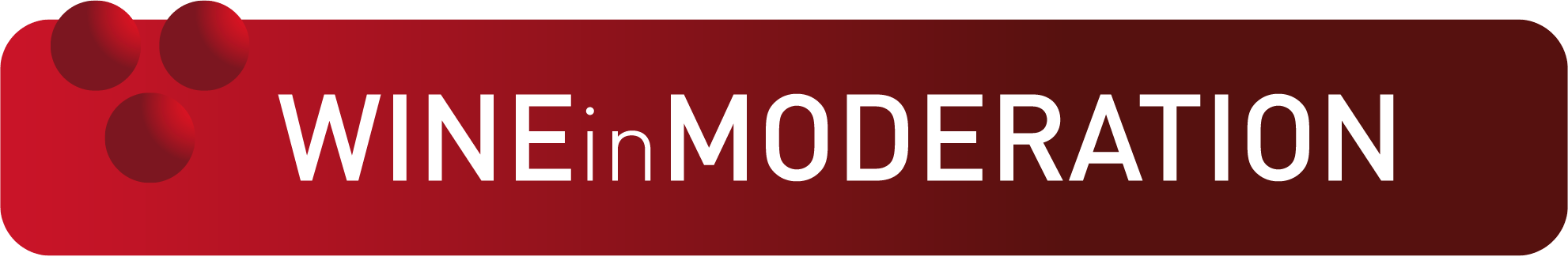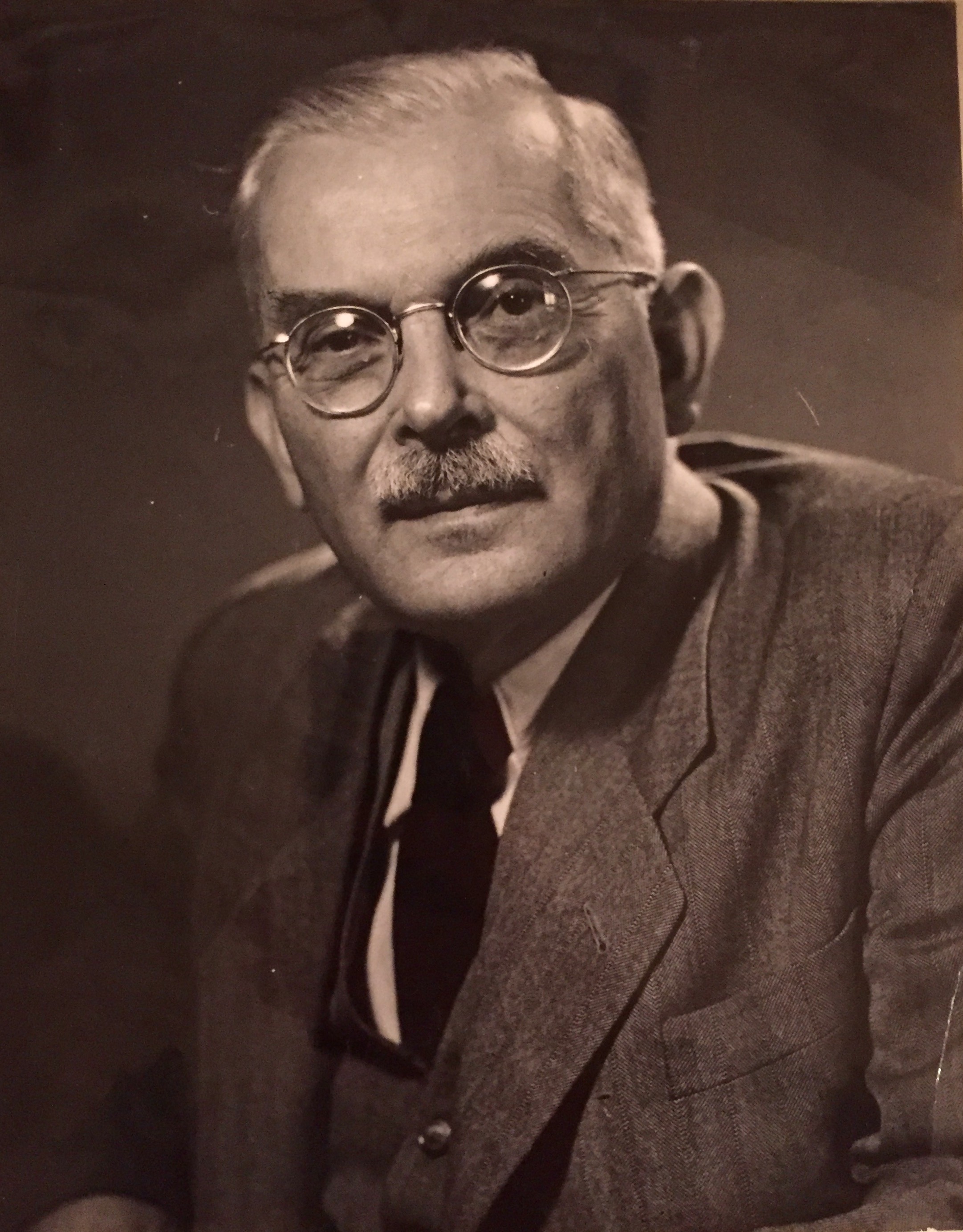
Dr. Carl JUNG jun. – Weinhändler, Pionier der Entalkoholisierung
* 17. Mai 1878 in Lorch (Rheingau)
† 18. August 1965 in Rüdesheim am Rhein
Carl Jung erhielt seine schulische Ausbildung am Konvikt in Montabaur, welches er 1898 mit dem Abschluss der Hochschulreife verlassen konnte. Passend dazu hatte er anschließend den Wunsch, Priester zu werden und begann das Studium der Theologie in Münster. Doch am Ende kam es anders. J. wechselte nach Tübingen und inhaltlich zur Staatswissenschaft, wo er im Sommer 1902 auch promoviert wurde. Anschließend kehrte er in den Rheingau zurück, um im Lorcher Familienbetrieb mitanzupacken.
Dort hatte die Familie bereits im Jahr 1823 mit dem Weinbau begonnen. J.s Vater (ebenfalls Carl) hatte den Beruf des Küfers erlernt und wurde später Winzer im Vollerwerb. 1868 gründete er ebenfalls in Lorch die Firma Carl Jung als Weinhandlung mit angeschlossener Brennerei. Bei Verkauf ihrer Weine erhielten die Jungs im Laufe der Jahre immer wieder Absagen, da die potenziellen Käufer aus Gesundheitsgründen abwinken mussten. Um diesem Trend entgegen wirken zu können, reifte die Idee, dem Wein den Alkohol einfach zu entziehen, damit er ohne dessen schädliche Wirkung genossen werde könne. Was auf den ersten Blick so einfach klingt, erschien den meisten Zeitgenossen zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch als völlig absurder Plan.
Carl (junior) machte die Entalkoholisierung folglich zu seinem Projekt und er war es dann auch, der später als Pionier der Entalkoholisierung von Weinen in die Geschichte eingehen sollte.
Im heimischen Betrieb begann er mit praktischen Versuchen zur Entalkoholisierung von Weinen. Inspiriert von einem Bericht über eine Bergsteigermission im Himalaja, wo er lesen konnte, dass sich mit zunehmender Höhe die Siedetemperatur des Wassers von 100 auf 70 °C senkte, versuchte er dem familieneigenen Riesling seinen Alkohol zu entziehen. Schnell erkannte er jedoch, dass dies nur unter Vakuum möglich ist. Dadurch ließ sich die Destillationstemperatur so weit senken, dass ein störender „Kochgeschmack“ vermieden wurde. Gleichzeitig musste seine Apparatur aber auch so konstruiert werden, dass die unterschiedlichen Flüchtigkeiten von Alkohol und Aromastoffen genutzt werden konnten. Zum bestmöglichen Geschmackserhalt des Weins sollen nämlich beide möglichst getrennt voneinander aufgefangen und die Aromenfraktion hernach dem entakoholisierten Wein wieder zugeführt werden. Dies ermöglicht eine schonende Entalkoholisierung ohne größere Aromenverluste. Damit hatte er ein damals komplett neues Verfahren entwickelt. 1907 war es dann so weit, Jung konnte seine Erfindung beim kaiserlichen Patentamt einreichen, welche dort mit der Nummer 204595 patentiert wurde. In der Beschreibung wurde betont: „Dieses Verfahren hat den Zweck, aus Wein ein alkoholfreies Getränk zu erzeugen, das in Aussehen, Geschmack und Blume dem Naturwein möglichst ähnlich ist.“ Im Folgenden wurde das technische Verfahren erläutert, bei dem der Wein mittels Vakuumdestillation „entgeistet“ wurde. Und da er dabei teilweise bekannte Verfahren benutzte, wurde klargestellt: „Das Neue und den Gegenstand vorliegender Erfindung bildende Merkmal ist daher lediglich der vom Erfinder eingeschlagene eigenartige Weg zur Gewinnung und Abscheidung der Aromastoffe.“
Doch die weitere Entwicklung war alles andere als ein Selbstläufer. Wiederholt wurde die Firma Jung mit Klagen überzogen. Bis 1939 gab es allein acht Gerichtsurteile, in den festgeschrieben wurde, dass der Begriff „alkoholfreier Wein“ nicht irreführend sei. Einleuchtend hieß es: „Dieser Begriff ist aber auch nicht widersprüchlicher als ein koffeinfreier Kaffee, entrahmte Frischmilch, oder gegorener Most.“ Gleichzeitig lieferte der zunehmende Verkaufserfolg den Jungs auch die Bestätigung, dass sie wirtschaftlich auf dem richtigen Weg waren. Weltgeschichtliche Ereignisse, wie die Prohibition in Amerika während der 1920er und 1930er Jahre, trugen dazu bei.
Kurz darauf, im Jahr 1939 folgte der Wechsel des Unternehmens nach Rüdesheim. Dort konnten die Jungs dank ihrer erfolgreichen Geschäfte die repräsentative Boosenburg erwerben, wo zuvor die traditionsreiche Weinhändlerfamilie Sturm ihren Geschäften nachgegangen war. Dort bezogen die Jungs fortan auch ihren Wohnsitz und sind seitdem ein Rüdesheimer Unternehmen. J. blieb zeitlebens eng mit der Firma verbunden und arbeitete bis zu seinem Tode aktiv in der Geschäftsleitung mit. Bereits im Jahr 1950 hatte sein Sohn Hans Otto die Geschäftsführung übernommen.
Ansonsten war J. ein überaus vielseitig interessierter und begabter Mann. So galt er auch als ausgesprochener Liebhaber der Kammermusik und organisierte insbesondere in den 1920er Jahren in Lorch zahlreiche Konzerte. Und auch nach dem Umzug in die Rüdesheimer Boosenburg blieb er ein großer Liebhaber der Musik und verband dies mit einer überaus repräsentativen Haushaltsführung.
Bemerkenswert ist auch seine persönliche Verbindung zu Karl May. Bereits als Schüler hatte er dessen Bücher verschlungen und einen Briefkontakt mit dem berühmten Autor begonnen. Es folgten persönliche Treffen in Radebeul und Lorch, bevor der Kontakt nach der Jahrhundertwende langsam wieder einschlief.
Während der Zeit des Dritten Reiches galt J. den Nationalsozialisten als politisch unzuverlässig und musste zeitweise sogar für mehrere Monate in Haft. Glücklicherweise überlebte er – ebenso wie die Rüdesheimer Firma – die Zeit des Zweiten Weltkrieges weitestgehend unbeschadet, so dass er nach 1945 den eingeschlagenen Weg fortsetzen konnte und sich weiterhin um die Förderung alkoholfreier Weine und Sekt kümmern konnte. Im Jahr 1961 erhielt er für seine vielfältigen Verdienste das Bundesverdienstkreuz. J. starb am 18. August 1965 in Rüdesheim, wo noch heute auf dem Friedhof ein Grabstein an einen der bedeutendsten Rheingauer Pioniere des 20. Jahrhunderts erinnert.
Quellen
- Firmenarchiv Dr. Carl Jung, Rüdesheim
Auskünfte der Familie - Stadtarchiv Rüdesheim am Rhein
Autor:
Oliver Mathias, Geisenheim, Juni 2025

Friedrich Wilhelm DÜNKELBERG, Agrar- und Forstwissenschaftler, Ersteller der ältesten Weinlagenkarte der Welt
* 4. Mai 1819 in Schloss Schaumburg/Lahn
† 11. August 1912 in Wiesbaden
Vater: Dünkelberg, Johann Friedrich der Jüngere (1775 – 1828), Forstmeister und Kammermeister in Schaumburg
Mutter: Johannette Anne Margarethe, geborene Unger (1789 – 1828)
⚭ 1958 Catherina Maria Friederike Adeline geb. Stadtfeld (1823 – 1894), 2 Söhne und 2 Töchter
⚭ 1895 Wanda Maria Amalie geb. von Leyser (1857 – 1909)
Friedrich Wilhelm Dünkelberg besuchte ab 1841 das herzoglich nassauische Landwirtschaftliche Institut Geisberg bei Wiesbaden und setzte 1844 sein Studium an der Universität Gießen fort. Dies schloss er 1846 mit einem Praktikum am Chemischen Laboratorium Fresenius ab. Am 1. April 1847 wurde er Lehrer für Naturwissenschaften und Kulturtechnik an der Ackerbauschule zu Merchingen und lehrte ab 1849 als Privatdozent an der landwirtschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf/Bonn. Am 4. Mai 1850 promovierte D. an der Universität Jena mit der Abhandlung „Die Ackerbauschule, ein Bild der Wirklichkeit und der Idee“. Von 1850 bis 1871 lehrte er am Institut Hof Geisberg bei Wiesbaden, ab 1858 als Professor.
In dieser Zeit entstand auch eine Weinlagenkarte des Rheingaus, der nach derzeitigem Kenntnisstand ältesten Weinlagenkarte der Welt. Von 1871 bis 1895 war er Professor und Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie Poppelsdorf/Bonn und begründete dabei die wissenschaftliche Kulturtechnik. D. forschte auf vielen Gebieten der Landwirtschaft. Auch wenn die Kulturtechniken und die richtige Standortwahl für Kulturpflanzenarten im Vordergrund standen, beschäftigte er sich ebenfalls mit Betriebswirtschaft und Viehzucht. Vermutlich entdeckte er die erste Reblaus in Deutschland auf dem Annaberg bei Bonn.
Quellen
- Dünkelberg, Friedrich Wilhelm. Hessische Biografie. (Stand: 9. Januar 2020). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).
- Mueller, Curtius: Friedrich Wilhelm Dünkelberg. ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften. Stuttgart, [1912] Sonderdruck aus „Zeitschrift für Vermessungswesen“ Heft 20, 1912.
- Babo, August Wilhelm 1875. Über das Auftreten der Phylloxera am Rheine. Zeitschrift für Weinbau und Kellerwirthschaft. 7. Jahrgang (1875), 25–26.
Veröffentlichungen (Auswahl):
- Die Landwirthschaft und das Capital: Zugleich ein Aufruf an Grundherrn, Gutsbesitzer, Capitalisten, Domainen-Verwaltungen und Rentkammern zur Einrichtung von Muster-Pachtungen. Wiesbaden, Verlag Wilhelm Roth,1860.
- Der Nassauische Weinbau: Eine Skizze der klimatischen, Boden- und Cultur-Verhältnisse des Rheingau‘s, nebst der allgemeinen amtlichen Statistik der Wein-Erträge aus den Jahren 1834, 1846 und 1857–1866. Aus Auftrag des Direktoriums des Vereins nassauischer Land- und Forstwirthe. Mit einer Weinbaukarte des nassauischen Rheingau‘s. Wiesbaden: Limbarth 1867.
- Dünkelberg, Friedrich Wilhelm. Encyclopädie und Methodologie der Culturtechnik. 2 Bände. F. Vieweg, Braunschweig 1883.
Autor:
Ernst Rühl, Geisenheim, März 2025
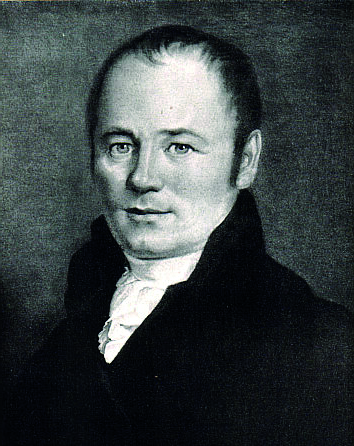 Karl Christian GMELIN, deutscher Botaniker und Naturforscher
Karl Christian GMELIN, deutscher Botaniker und Naturforscher
* 18. März 1762 in Badenweiler
† 26. Juni 1837 in Karlsruhe
Karl Christian Gmelin war Sohn eines Pfarrers und jüngerer Bruder des Kupferstechers Wilhelm Friedrich Gmelin. Nach sechsjährigem Studium der Medizin, mit besonderer Bevorzugung der Naturwissenschaften, an den Universitäten Straßburg und Erlangen, erwarb sich Gmelin 1784 in Erlangen den Doktorgrad und in Karlsruhe die Zulassung als praktischer Arzt. Außerdem lehrte er Naturgeschichte am dortigen Gymnasium, ein Amt, das er volle 50 Jahre versah.1786 wurde ihm auch die Direktion des fürstlichen Naturalien-Cabinets und die Aufsicht über die botanischen Gärten übertragen. 1794 brachte er die fürstlichen Sammlungen nach Ansbach. Die zweieinhalb Jahre, die er dort blieb, benützte er zu Studien in dem nahen Erlangen. Das wachsende Naturalien-Cabinet zeigt seinen Sammeleifer und der ihm anvertraute botanische Garten stand in den Kreisen der Naturforscher seiner Zeit in hohem Ansehen.
Dem Garten galten auch seine ersten Schriften: die beiden Auflagen des Catalogus plantarum horti Carlsruhani (1791 und 1800), denen 1811 noch ein Hortus Magni Duci Badarum Carlsruhanus folgte. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet C. C. Gmel. Sein Hauptwerk ist die Flora Badensis Alsatica et confinium regionum cis et transrhenana, das wegen seiner guten Speziesbeschreibung und sorgfältigen Zitierens der Literatur für seine Zeit mustergültig war. Das 1809 erschienene Buch Ueber den Einfluß der Naturwissenschaften auf das gesamte Staatswohl, zeigt, dass G. durchaus die Bedeutung wissenschaftlicher Arbeit für das Gemeinwesen im Auge hatte.
Für den Weinbau bedeutend ist seine Beschreibung der damals in den Rheinauen häufigen europäischen Wildrebe Vitis sylvestris C. C. Gmel. bzw. Vitis vinifera subsp. sylvestris C. C. Gmel. bzw. Vitis gmelinii Buttler in seiner Flora Badensis Alsatica. Außerdem hat er 1821 in den Verhandlungen des landwirtschaftlichen Vereins in Ettlingen die Barttraube (Laska) beschrieben, die als Wundertraube für regen Gesprächsstoff gesorgt hatte.
Quellen:
- Gmelin, Moriz: Gmelin, Karl Christian. In: Allgemeine Deutsche Biographie 9 (1879), S. 271–272. [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118966243.html#adbcontent (24.04.2024).
- Gmelin, Carolus Christiano: Flora Badensis Alsatica. Tom. 1–4. Carlsruhae 1805–1826.
- https://www.ipni.org/n/urn:lsid:ipni.org:names:69086-1 (24.04.2024).
Ernst Rühl, Geisenheim, April 2024

Günter STAUDT, Botaniker, Zytologe, Genetiker, Direktor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg
* 26. August 1926 in Berlin
† 22. Mai 2008 in Bad Krozingen
⚭ Dr. med. Anneliese Staudt, geb. Werner; 2 Kinder (Rainer, Dieter)
Nach dem Besuch des Grunewald-Gymnasium in Berlin von 1937 bis1944 studierte Günter Staudt von 1946 bis 1950 an der Humboldt-Universität zu Berlin Biologie und Chemie. Anschließend wurde er dort 1952 bei Prof. Elisabeth Schiemann zum Dr. rer. nat. promoviert. S. blieb nach der Dissertation bis 1956 als wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Schiemann an der Forschungsstelle für Geschichte der Kulturpflanzen der Max-Planck-Gesellschaft. Von 1956 bis 1963 arbeitete er am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln und wechselte danach im Rahmen eines Habilitandenstipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft an das Institut für Vererbungsforschung der Technischen Universität Berlin und habilitierte sich dort 1966 bei Prof. W. Hoffmann. Bis dahin hatten Erdbeeren im Mittelpunkt seiner Arbeiten gestanden. Neben zahlreichen genetischen und zytologischen Untersuchungen beschrieb er erstmals die ostasiatische Iturup-Erdbeere (Fragaria iturupensis Staudt) als oktoploide Wildart. Mit dem Wechsel 1967 an die Bundesforschungsanstalt für Rebenzüchtung, Geilweilerhof, in Siebeldingen als Leiter der Abteilung Genetik und Zytologie änderte sich seine wissenschaftliche Ausrichtung. Von nun an standen Reben im Mittelpunkt seiner Forschungen. Im Jahr 1974 wurde er Direktor und Professor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg. Dieses Amt übte er bis zum Beginn seines Ruhestands 1991 aus. Seiner Leidenschaft für Genetik und Zytologie blieb er auch in der Rebforschung treu mit Arbeiten zur Meiosis von di- und tetraploidem Riesling, dem Pollenschlauchwachstum und dem Verrieseln bei verschiedenen Rebsorten, der Jungfernfrüchtigkeit verschiedener Rebsorten sowie Studien zur Blüten- und Beerenentwicklung sowie Resistenz von Reben gegen den Falschen Mehltau Plasmopara viticola. Darüber hinaus entwickelte er eine Schnellmethode zur Ermittlung der Virus-Übertragungsresistenz bei Unterlagen und Wildarten.
Quellen:
-
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek - https://d-nb.info/gnd/
1059947080 (Stand: 11.11.2024) -
Biographisches Lexikon zur Geschichte der Pflanzenzüchtung 2. Folge - Gesellschaft für Pflanzenzüchtung AG Geschichte der Pflanzenzüchtung, erschienen als Heft 55 der Vorträge für Pflanzenzüchtung. Göttingen 2002, p. 302-302.
Veröffentlichungen (Auswahl):
-
Staudt, Günter: Cytogenetische Untersuchungen an Fragaria orientalis und ihre Bedeutung für Artbildung und Geschlechtsdifferenzierung in der Gattung Fragaria. Diss. v. 9. April 1952.
-
Habilitationsschrift an der TU Berlin vom 19. Februar 1966 veröffentlicht in 3 Teilen:
-
Staudt, Günter: Genetics and Evolution of heteroecy in Genus Fragaria. 1. Investigations on Fragaria orientalis. In: Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band 58(3), 1967, S. 245 – 277.
-
Staudt, Günter: Genetics and Evolution of heteroecy in Genus Fragaria. 2. Interspecific crosses F. vesca x F. orientalis and F. viridis x F. orientalis. In: Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band 58(4), 1967, S. 309 – 322.
-
Staudt, Günter: Genetics and Evolution of heteroecy in Genus Fragaria. 3. Investigations on hexaploid and octoploid species. In: Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band 59(1), 1968, S. 83 – 102.
-
Staudt, Günter: Eine spontan aufgetretene Großmutation bei Fragaria vesca L. In: Naturwissenschaften. Band 46(1), 1959, S. 23.
-
Staudt, Günter: Systematics and geographic distribution of the American strawberry species: taxonomic studies in the genus Fragaria (Rosaceae: Potentilleae). Univ. of Calif. Press, Berkeley [u. a.] 1999.
-
Staudt, Günter: Les dessins d‘A. N. Duchesne pour son Histoire naturelle des fraisiers. Muséum Nat. d‘histoire Naturelle, Paris 2003.
-
Staudt, Günter: Fragaria iturupensis, eine neue Erdbeerart aus Ostasien. In: Willdenowia, Bd. 7, H. 1, 1973, S. 101 – 104.
-
Staudt, Günter: Entstehung und Geschichte der großfrüchtigen Gartenerdbeeren: Fragaria x ananassa Duch. Der Züchter 31(1961), S. 212 – 218.
-
Staudt, Günter: 1968. Die Genetik und Evolution der Heterözie in der Gattung Fragaria. Verlag Paul Parey. Berlin, Hamburg.
-
Staudt, Günter und M. Kassrawi, 1972: Die Meiosis von di- und tetraploidem Vitis vinifera „Riesling“. Vitis 11, S. 89 – 98.
-
Schneider, W. und G. Staudt, 1978: Zur Abhängigkeit des Verrieselns von Umwelt und Genom bei Vitis vinifera. Vitis 11, S. 45 – 53.
-
Staudt, Günter: Pollenkeimung und Pollenschlauchwachstum in vivo bei Vitis und die Abhängigkeit von der Temperatur. Vitis 21(1982), S. 205 – 216.
-
Staudt, Günter, W. Schneider und J. Leidel 1986: Phases of berry growth in Vitis vinifera. Ann. Bot. 58(1986), S. 789 – 800.
-
Staudt, Günter: Opening of flowers and time of anthesis in grapevines, Vitis vinifera L. Vitis 38(1999), S. 15 – 20.
-
Staudt, Günter, H. H. Kassemeyer: A quick-test for screening resistance to transmission of grapevine fanleaf virus by Xiphinema index. Vitis 36(1997), S. 155 – 156.
Bildquelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Fotograf: Willy Pragher
Ernst Rühl, Geisenheim, Oktober 2024

Sigmund TELEKI – Zsigmond Teleki (Taussig), österreichisch-ungarischer Weingutsbesitzer, Weinhändler, Rebschulist und Unterlagenzüchter
* 24. September 1854 in Villány, Ungarn
† 20. August 1910 in Villány, Ungarn
Vater: Abraham Taussig
Mutter: Tina Taussig, geb. Weisz
verheiratet mit Matild Teleki, geb. Spitzer, Kinder: Andor Teleki, Trusci Berkovich, geb. Teleki, Alexander (Sandor) Teleki.
Sigmund Teleki absolvierte seine Ausbildung in Budapest und Wien, wo er nach Abschluss des Studiums in einer Bank arbeitete. Nach dem Konkurs der Bank wurde er Agent der Würzburger Weinhandelsgesellschaft. Von da an beschäftigte er sich dauerhaft mit Wein und Weinbau. Durch seine Arbeit bereiste T. viele europäische Weinbauregionen, wobei ihm seine Mehrsprachigkeit hilfreich war. Im Alter von 27 Jahren kehrte er 1881 nach Pecs (Ungarn) zurück und eröffnete ein Weingeschäft. Auf seinen Reisen durch europäische Weinbaugebiete war ihm bereits der gefährlichste Rebschädling, die Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) begegnet. Sie machte auch vor seiner ungarischen Heimat nicht halt und verwüstete viele Weinberge. Auf einem solchen 5 ha großen Weinberg pflanzte er als Versuch die damals vorhandenen Unterlagen wie Riparia portalis, Rupestris du Lot, Rupestris metallica, Aramon x Rupestris Ganzin 1, Mourvedre x Rupestris 1202 C und Solonis. Doch auf den kalkhaltigen Böden wuchsen die Reben schlecht und litten unter Chlorose. Diese Unterlagssorten waren also für seine Kalk-Standorte ungeeignet. Besser angepasste Unterlagen waren dringend notwendig, um den Weinbau auch auf solchen Standorten zu erhalten.
Jules-Emile Planchon und Pierre Viala, zwei Wissenschaftler aus Montpellier, hatten die Wildform Vitis berlandieri als besonders kalktolerant beschrieben, aber die Stecklinge bewurzelten sich sehr schlecht und waren für einen unmittelbaren Einsatz ungeeignet. Auf einer seiner Reisen nach Frankreich hörte T. von dieser Wildform. Der französische Rebenveredler Euryale Rességuier aus Alénya verkaufte in den 1890er Jahren an Planchon Stecklinge, Pfropfreben und Rebkerne von zwei Selektionen der kalktoleranten Vitis berlandieri. Von ihm bezog T. 1896 10 kg Rebkerne der Selektion Rességuier#1. Aus den ca. 40.000 Kernen zog er Sämlinge auf. Leider musste er feststellten, dass es sich nicht, wie von ihm erwartet, um reine, einheitliche Vitis berlandieri Nachkommen handelte, sondern dass viele verschiedene Formen auftraten und es sich vielfach um Kreuzungen mit Vitis riparia handelte. Er teilte daher die Population aufgrund ihres Aussehens und der vermutlichen Abstammung in zehn verschiedene Gruppen. Zusätzlich unterschied er die Pflanzen noch aufgrund ihrer Triebbehaarung in A (unbehaart) und B (behaart). Pflanzen mit der Bezeichnung 5A sahen also eher wie Riparia aus und hatten unbehaarte Triebe, während die der Gruppe 8B eher wie Berlandieri aussahen und behaarte Triebe aufwiesen. Die Gruppen 5A und 8B hielt T. für besonders geeignet. Zwischen 1902 und 1904 übergab T. seine zehn besten Selektionen an den österreichischen Weinbauinspektor Franz Kober, der damals die Weinbaustation Nussberg bei Wien leitete. Er selektionierte das Material weiter und gewann daraus Unterlagen wie Kober 5BB oder Kober 125AA.
Nach dem Tod Sigmund Telekis (1910) setzten seine Söhne Andor und Alexander seine Arbeiten fort. So gelangten 1912 einige seiner Zuchtstämme nach Oppenheim, aus denen der damalige Direktor Fuhr die Unterlage Selektion Oppenheim 4 (SO4) auslas. Ähnlich ging es mit weiteren Lieferungen von Teleki 5A oder 8B an verschiedene Züchter in Europa, die daraus Klone der Unterlagen Kober 5BB, der Kober 125AA, Teleki 8B oder auch die Sorte 5C Geisenheim auslasen. SO4 und Kober 5BB gehören heute, wegen ihrer guten Reblaus- und Kalktoleranz, sowie ihrer guten Veredlungs- und Bewurzelungsfähigkeit zu den wichtigsten Rebunterlagen nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit. Der Visionär T. hat hiermit einen entscheidenden Beitrag zu einer nachhaltigen, biologischen Bekämpfung der Reblaus durch die Verwendung toleranter Unterlagen geleistet.
Quellen:
-
https://www.geni.com/people/Zsigmond-Teleki/6000000004190529016 (11.11.2024)
-
J. Schmid, F. Manty, B. Lindner: Geisenheimer Rebsorten und Klone. Geisenheimer Berichte 90. 3. Auflage 2019. ISBN 978-3-934742-56-7
-
Müller, K.: Das Weinbaulexikon. 1930.
-
Teleki, Andor: Der Moderne Weinbau – Die Rekonstruktion der Weingärten. A. Hartleben’s Verlag, Wien und Leipzig. 3. Auflage 1927.
-
Sterberegister Villány: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PBS-VCF?i=197&cc=1452460&cat=775517 (11.11.2024)
Bildquelle: Wikipedia commons
Ernst Rühl, Geisenheim, Oktober 2024