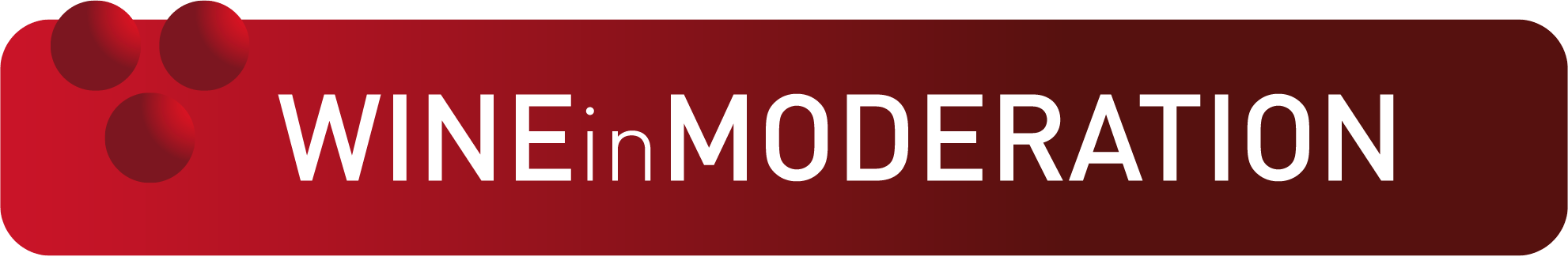2025: The World of Wine. (Part 4)
Pena, Camilo/Almila, Anna-Maria und Inglis, David/Ly, Pierre und Howson Cynthia: The World of Wine. (Part 4). In: Joy, Annamma (Hrsg.): „Sustainability in Art, Fashion and Wine; critical Perspectives“. 324 Seiten (Part 4: S. 261 – 309). Engl. Walter de Gruyter GmbH Berlin/Boston 2024. ISBN 978-3-11-078389-6. E-Book und broschiert:
54,95 Euro.
 Nachhaltigkeit ist das derzeitige Schlagwort, das von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf praktisch allen Ebenen und Bereichen diskutiert und nachgefragt wird. „Nicht mehr ausgeben, als hereinkommt, von den Zinsen leben, ohne das Kapital anzugreifen oder: die Ressourcen der Erde nicht überlasten“ sind gängige Erläuterungen dieses Begriffes. Erstmals geprägt wurde er von Freiherr Hans Carl von Carlowitz bereits im Jahre 1713, als er realisierte, was mit Wäldern geschieht, wenn mehr Bäume gefällt werden, als nachwachsen können.
Nachhaltigkeit ist das derzeitige Schlagwort, das von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf praktisch allen Ebenen und Bereichen diskutiert und nachgefragt wird. „Nicht mehr ausgeben, als hereinkommt, von den Zinsen leben, ohne das Kapital anzugreifen oder: die Ressourcen der Erde nicht überlasten“ sind gängige Erläuterungen dieses Begriffes. Erstmals geprägt wurde er von Freiherr Hans Carl von Carlowitz bereits im Jahre 1713, als er realisierte, was mit Wäldern geschieht, wenn mehr Bäume gefällt werden, als nachwachsen können.
Das vorliegende Buch widmet sich nach einer Einleitung durch die Herausgeberin in drei längeren Teilen der Welt der Kunst, der Mode und des Weines. Dass Mode Nachholbedarf an Nachhaltigkeit hat, lässt sich durch Zahlen belegen: von etwa 400 Mio. Tonnen Kunststoffen, die im Jahr weltweit produziert werden, entfallen 80 Mio. auf Kunststoffe in Kleidern, Verpackungen sind es demnach nicht allein. Derartige Informationen finden sich in dem soziologisch-politisch ausgerichteten Buch leider nicht. Stattdessen wird in einem einführenden Teil die Welt dieser drei Bereiche eingeordnet: sie ist geprägt durch einen neo-liberalen Rahmen und soziale Gerechtigkeit. Für Mitglieder der GGW dürfte vor allem der Abschnitt über die Welt des Weines interessant sein, der nachfolgend besprochen wird.
Teil 4 „Die Welt des Weines“ gliedert sich in drei Kapitel. „Nachhaltigkeitsvergleich bei konventioneller, organischer oder natürlicher Weinbereitung“, „Geschlechterspezifische Dynamik in der Umwandlung von Wein in Kunst“ und „Der Aufstieg chinesischer Edelweine durch institutionalisierte Innovationen: Ausländische Partnerschaften, einheimische Entrepreneurs und Hemmnisse aufgrund von Nachhaltigkeit“.
Das erste Kapitel, verfasst von Camilo Pena (Okanagan Valley, Canada), ist interessant für Technologen. Der Autor, Master in Sustainable Development und promoviert in Industrial Studies, vergleicht anhand mehrerer Kriterien in Form einer Tabelle (Ökosystem-Management, Boden, Energie- und Wassermanagement, Zusätze, Pflanzenschutz oder Weinausbau, soziale Aspekte) konventionell erzeugte Weine mit Bio-Weinen und Naturweinen. Der konventionelle Weinausbau, in Deutschland rund 85 Prozent aller Weine, besitzt Freiheiten im Pflanzenschutz und in der Kellerwirtschaft, die den beiden anderen Bereichen nicht zur Verfügung stehen. Deren Risiken sind im Jahr 2024 wieder besonders deutlich geworden, Peronospara hat schlimme Schneisen geschlagen. Zwischen dem Bio- und Naturweinausbau sind die Unterschiede eher gering. Diskutiert wird über die zulässige Menge an SO2 und einzelne Kellerbehandlungsmittel. Sog. Naturweine besitzen in Deutschland einen Marktanteil von rund einem Prozent, sie werden häufig in Quevris hergestellt und als Orange Weine angeboten. In der Denkweise des Autors ist es umso nachhaltiger, je weniger Behandlungsmittel eingesetzt werden. Als Rezensent würde ich Nachhaltigkeit eher in Richtung Kreislaufwirtschaft verstehen. Was geschieht mit dem Trester, was mit der Hefe oder dem sonstigen Trub? Deponie oder Rückführung als Dünger bzw. Weiterverarbeitung zu anderen Wertstoffen.
Im zweiten Kapitel von Anna Mari Almeda (Rom) und David Inglis (Helsinki) wird ein spannender englischer Begriff verwendet: Artifying Wine. Mit dessen korrekter Übersetzung tun sich auch Lexika schwer. Gemeint ist der Prozess vom Nicht-Kunstwerk zum Kunstwerk, vielleicht ist der Begriff „Künstlerisierung“ zulässig. Diese Entwicklung soll die Winemaker betreffen und die Etiketten auf den Flaschen. Alles im Kontext der Gender-Diskussion, denn Wein (und auch Kunst) war in der Vergangenheit patriarchalisch ausgerichtet. Beide sind nach Ansicht des Rezensenten allerdings eindeutig auf dem Weg der Veränderung. Die Autoren sehen dagegen weiterhin Defizite.
In dem Artifying-Prozess sollen Künstler und Winemaker im Zusammenhang gesehen werden. Künstleretiketten gibt es ja nicht erst seit oder bei Mouton-Rothschild. Bei vielen Betrieben gehören sie zum grundlegenden Marketing, um sich abzuheben von der Masse und identitätsbildend zu wirken. Auch die Weinherstellung soll ein Kunstwerk sein. In der Tat ist es für die meisten Produzenten ein Handwerk, in Großbetrieben mit aufwendiger Technologie durchgeführt. Besonders Weinjournalisten und Weinkritiker verwenden gerne den Begriff des Künstlers im Zusammenhang mit dem Winemaker, der seinen Wein interpretiert wie ein Maler sein Gemälde und ihn so quasi adelt. Der Artikel ist von Autoren geschrieben, die kultursoziologisch unterwegs sind.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Weinbau in China. Autoren sind Pierre Ly (USA) und Cynthia Howson (USA). Pierre Ly ist Professor für „International Political Economy (IPE)“ an der University of Puget Sound. Cynthia Howson ist Teaching Professor of Ethnic, Gender, and Labor Studies an der University of Washington. Berichtet wird über Erkenntnisse, die die Autoren zwischen 2013 und 2018 in China gewonnen haben. Sie sehen chinesische Weinproduzenten in einem harten Kampf gegen Vorurteile chinesischem Wein und China gegenüber, wegen widersprüchlicher Regulierungen der Bewässerung, geistigem Eigentum und nicht zuletzt sozialer Probleme um Klassen, Geschlechter, Ethnien und Sozialkapital. Vor allem das knappe Gut Wasser stellt viele Betriebe vor große Probleme (je Hektar Rebfläche sind 3.900 Tonnen Wasser nötig). Viele Herausforderungen sind vielfach mit Bastelei und Herumprobieren praktisch gelöst worden.
In den letzten Jahren hat die Reputation von chinesischem Wein deutlich zugenommen, auch wenn es keine Zusammenarbeit mit berühmten Weinmarken in der restlichen Welt gab. Drei der bekanntesten Betriebe werden von Frauen geführt, was in der Werbung stark ausgeschlachtet wird. Große ausländische Weinunternehmen haben sich wegen des im Prinzip gigantischen Marktes nach China orientiert. Neben dem Export von in der Regel teuren Weinen gab es auch mehrere Partnerschaften, die allerdings politisch eingeschränkt waren. Der Begriff Nachhaltigkeit taucht in dem Artikel allerdings unter, bei aufstrebenden Strukturen stehen andere Schwerpunkte im Vordergrund.
Dann kam Corona. Auch erfolgreiche Unternehmen, nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren und Fachleuten, haben durch die Pandemie schwer gelitten. Insgesamt ist die Situation des chinesischen Weinbaus seitdem noch volatiler und noch unvorhersehbarer. Angesichts extrem niedriger Temperaturen im Winter und all der Risiken wird chinesischer Wein im Gegensatz zu Solaranlagen oder Stahl kein Billigprodukt sein können, welches die europäischen Märkte überschwemmt.
Die Autoren sind durchgängig Wissenschaftler an Hochschulen und bringen einen eher theoretischen internationalen Blickwinkel mit, der etwas abseits des deutschen Weinverständnisses liegt. Er kann dadurch für diejenigen sehr spannend sein kann, die bereit sind, sich durch entsprechende sozio-kulturellen Fachbegriffe zu wühlen. Ein Naturwissenschaftler wie der Rezensent vermisst in dem Buch Graphiken, Zahlen und harte Fakten. Das Buch sucht eine andere Klientel als den praktizierenden Winemaker auch mit Geisenheimer oder Neustadter Hintergrund.
Jochen Hamatschek, Landau