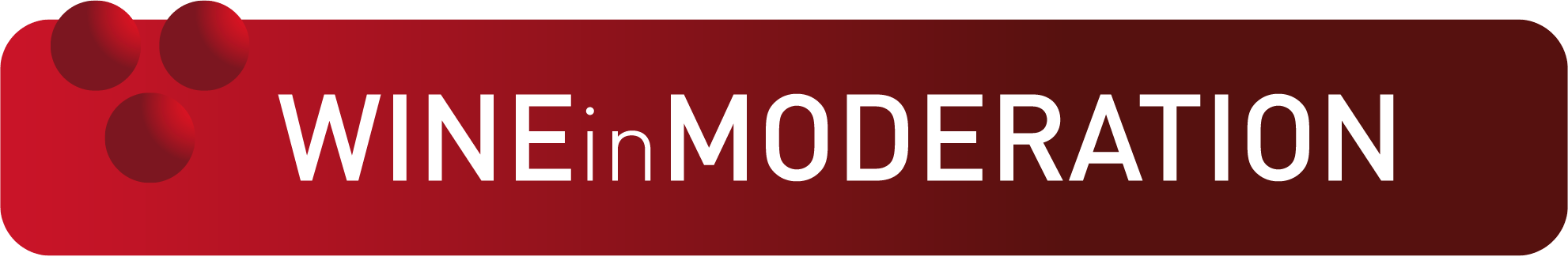2025: Reiner Wein. Philosophie zum Einschenken
Grätzel, Stephan/ Rehm-Grätzel, Patricia: Reiner Wein. Philosophie zum Einschenken. Verlag Königshausen & Neumann Würzburg 2022. 138 Seiten, kartoniert; ISBN: 978-3-8260-7583-4. 17,80 Euro.
 Stephan Grätzel ist emeritierter Professor für Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Patricia Rehm-Grätzel, Docteur des Lettres an der Université de Bourgogne, Dijon, lehrte am Département d’allemand der Université de Bourgogne, an der School of Humanities am Waterford Institute of Technology, Irland, und am Philosophischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Derzeit arbeitet sie als Lehrerin für Deutsch und Französisch am Bischöflichen Willigis-Gymnasium Mainz.
Stephan Grätzel ist emeritierter Professor für Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Patricia Rehm-Grätzel, Docteur des Lettres an der Université de Bourgogne, Dijon, lehrte am Département d’allemand der Université de Bourgogne, an der School of Humanities am Waterford Institute of Technology, Irland, und am Philosophischen Seminar der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Derzeit arbeitet sie als Lehrerin für Deutsch und Französisch am Bischöflichen Willigis-Gymnasium Mainz.
Dem Autorenpaar gelingt es, bereits im Vorwort nicht nur Spannung und mit einem ansprechenden Sprachstil Vorfreude für den Hauptteil aufzubauen, sondern auch die Wahl des Buchtitels ernsthaft und doch vergnüglich zu erklären. Im ersten Kapitel wird die spirituelle Verbindung von Philosophie und Wein behandelt. Die Begegnung mit der Philosophie des Weines von Béla Hamvas macht Lust darauf, mehr über ihn und seine Philosophie zu erfahren. Seine Betrachtungen sind für die Autoren grundlegend und werden im weiteren Verlauf des Buches immer wieder aufgegriffen. Im zweiten Kapitel werden die Reflexionen des Weins, seine Widerspiegelungen der Wahrheit im Leben und Bewusstsein aufgefächert. Hierbei geht es zunächst um die Sinnlichkeit des Weins. Der Wein wird aber auch als Träger von Erinnerungen behandelt. Damit kommen die Autoren zu den Grundfragen des Denkens, der Suche nach dem Grund des Lebens und seinem Sinn. In diesem Kapitel wird gezeigt, warum der Wein in unserer Kultur einen so hohen Stellenwert bekommen konnte. Um ihn und seine Bedeutung ganz zu verstehen, reicht die Betrachtung der Sinnlichkeit, der fünf Sinne nicht aus, sondern es ist – nach Auffassung des Autorenduos – eine Verbindung zum Übersinnlichen erforderlich. Im dritten Kapitel legen sie dar, wie Wein mythologisch, religiös, literarisch und ganz alltäglich gefeiert wurde und wird. Sie stellen den Wein als Protagonisten der Wahrheit auf der Bühne des Lebens dar.
Wem soll ich dieses Buch empfehlen? Ich kann es allen Leserinnen und Lesern ans Herz legen, die bereit sind, die traditionellen Pfade naturwissenschaftlicher und önologischer Weinvorstellungen zu verlassen. Das Autorenpaar nennt das, „Wein neu zu denken“. Hierauf komme ich nochmals zurück. Das Buch ist aber auch deshalb empfehlenswert, weil es in den Kapiteln immer wieder überraschende Gedankenzusammenhänge anbietet, die neugierig machen, über die es sich lohnt nachzudenken oder sich weitere Informationen einzuholen.
Bemerkungen wie „Die Wende vom Selbstverständlichen zum Staunenswertesten ist der Ursprung der Philosophie“ schärfen die Aufmerksamkeit beim Lesen. So auch das nachfolgende Beispiel: „Der Wein teilt also das Schicksal mit dem Geist, auf einen bestimmten Stoff reduziert zu werden: der Wein auf Alkohol, der Geist auf Gehirn. Dabei sind diese sogenannten Stoffe noch nicht einmal ausschlaggebend für das, was sie auch rein stofflich sind: Wein ist kein Alkohol, sondern ein Genuss und Lebensmittel, Geist ist kein Gehirn, sondern der Umgang mit anderen, mit der Natur, auch mit sich selbst.“ Ja, ein Gedankengang, der in der alkoholpolitischen Diskussion von höchster Aktualität ist. Wer mit dem ungarischen Philosophen Béla Hamvas (1897 – 1968) bisher nicht viel anfangen konnte, der wird mit dessen Philosophie des Weins, die in dem Buch eine große Rolle spielt, viel Freude haben. Ein Beispiel: „Die Sinnlichkeit der Welt und der Genuss des Lebens kommen beim Trinken am besten zur Geltung.“ Die Autoren verweisen darauf, dass sich hierbei Hamvas vor allem für den Wein interessiert, „aber nicht nur wegen seiner Qualität, sondern vor allem deshalb, weil er für ihn ‘wie ein flüssiger Kuss’ ist.“ Darüberhinaus gibt Hamvas dem Wein die bedeutende Rolle einer allgemeinen und universalen Stellvertretung des Lebens.
Die Lesefreude wird erhöht durch Passagen wie: die Kneipe gehört „zu den wichtigsten Einrichtungen unserer Zivilisation, denn an diesem Ort werden Wunden geheilt, die dem Menschen in der Öffentlichkeit und durch die Regierung geschlagen werden. [...] Die Kneipe wird hier nicht als der Ort des einsamen Versinkens inmitten vieler Isolierter verstanden und der Wein wird auch nicht nur als ein Getränk oder eine Art Alkohol verstanden, mit dem man sich betäubt. Vielmehr treffen sich hier die Gleichgesinnten, die gemeinsam den Genuss des Lebens feiern.“
In dem Kapitel Wein und Maske gibt es Passagen, die beim Rezensenten doch Zweifel haben aufkommen lassen, ob die Philosophie des ungarischen Philosophen mit seiner Verherrlichung des Rausches, um zur Erleuchtung und damit paradoxerweise „zu einer höheren Nüchternheit“ zu kommen, uns in der heutigen gesellschaftlichen Diskussion Hilfestellung bieten kann. Es gibt auch andere Aussagen in weiteren Kapiteln, denen der Rezensent nicht zustimmen würde, aber sie bieten Gesprächsstoff mit anderen Perspektiven und einem anderen Zugang zur Weinkultur und zur Weinphilosophie. Die Diskussion über ein neues Verständnis von Kultur und Natur wird ebenso aufgegriffen wie die Gratwanderung der Weinbranche auf den Narrativen von Weinphilosophen und der Marketingexperten. In den Kapiteln über die Reflexionen des Weines, bei den Unterkapiteln Poesie des Weines, Architektur des Weins etc. habe ich oft ein Ausrufe- oder auch Fragezeichen (wenn es z. B. um die Heilkräfte geht) an den Rand gesetzt, natürlich nur mit dem Bleistift, zum späteren Wegradieren, denn das Buch soll rein bleiben.
Meine Leseempfehlung wird nicht dadurch gemindert, wenn ich zum Schluss auf eine Passage zurückkomme, der ich nicht zustimmen kann oder von der ich mehr oder eine andere Weiterführung erwartet hätte: „Wein zu denken oder auch neu zu denken bedeutet, ihn auch zu einem Erlebnis werden zu lassen, bei dem die gesamte sinnliche, leibliche und geistig geistliche Symbolik wieder eingebracht wird. D. h. aber auch, den Wein auf alte und wahrscheinliche Weise zu denken. Das neu ist auch eine Rückkehr zur kultischen Bedeutung des Weines und seiner Heiligkeit.“ Auch ich bin der Meinung, dass wir Weinkultur neu denken müssen, aber meines Erachtens nicht mit einem Zurück zur kultischen Bedeutung alter Zeiten. Ich hoffe zumindest nicht, dass der Lebensstil und die Weinkultur der Zukunft kultische Züge einer Vergangenheit tragen, die auch von berauschten Männern und von benachteiligten Frauen geprägt war. Anders gewendet: In einer Zeit, in der uns geradezu fundamentalistische Alkoholgegner unter Berufung auf WHO und DGE die Mär verbreiten, dass bereits der erste Tropfen Wein in jedem Fall gesundheitsschädlich sei, ist das Eintreten für einen aktuellen Weinkulturdiskurs äußerst verdienstvoll. Dem Buch wünsche ich viele Leserinnen und Leser, die bereit sind, Weinkultur neu zu denken und zukunftsweisend zu gestalten.
Rudolf Nickenig, Remagen