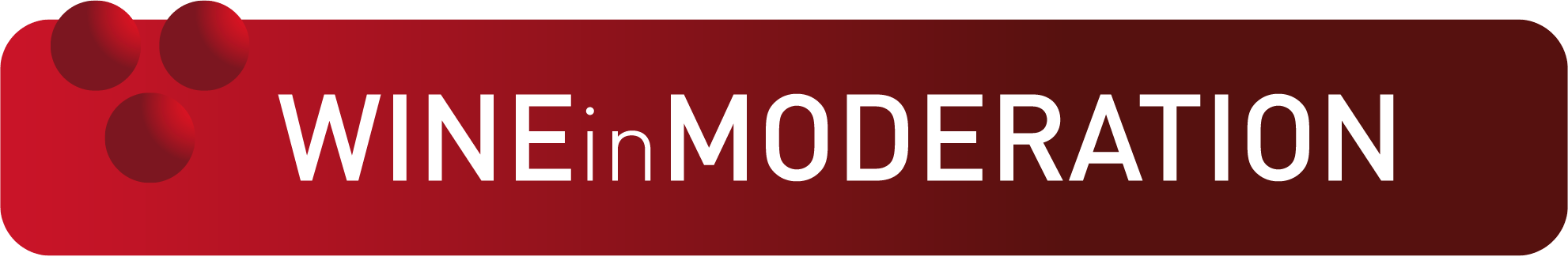Bieber, Helmut (1918 – 1975)

Helmut BIEBER, Dr. rer. nat.
* 1918 in Würzburg
† 26. September 1975 in Würzburg
Vater: Georg Bieber
Helmut Bieber war das älteste von vier Kindern des Amtgerichtsrates Georg Bieber. Geboren in Würzburg hat er den größten Teil seines Lebens bis zu seinem frühen Tod in dieser Stadt verbracht. Nach vier Jahren Volksschule der Übertritt aufs Pro-Gymnasium in Miltenberg, von 1933 das humanistische Gymnasium in Würzburg. Im Frühjahr 1937 endete die Schulzeit mit der Reifeprüfung.
Nach sechs Monaten im Reichsarbeitsdienst, aus Gesundheitsgründen und auch aus beruflichen Gründen vom Wehrdienst befreit, arbeitete er ab September 1937 als Praktikant in der Bavaria-Apotheke in Würzburg. Zwei Jahre später legte er das pharmazeutische Vorexamen ab, um danach sechs Semester Pharmazie in München zu studieren. Nach der pharmazeutischen Staatsprüfung im März 1942 trat er als wissenschaftliche Aushilfskraft in die Staatliche Chemische Untersuchungsanstalt in Würzburg ein. Parallel studierte er Lebensmittelchemie an der Julius-Maximilians-Universität und legte die Staatliche Chemikerprüfung im November 1943 ab. Von Januar 1944 an war er weiter wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an der Chemischen Untersuchungsanstalt. Zwischen Januar 1943 und Dezember 1944 verfasste er seine Promotionsschrift, die er ein Jahr später vorlegte. Thema: „Über die Entsäuerung von Traubenmost und Wein mit kohlensaurem Kalk in chemisch-analytischer und rechtlicher Hinsicht“. Aufgrund der Kriegswirren dauerte es bis 1947, um offiziell im Fach Lebensmittelchemie promoviert zu werden.
Das Gebäude in der Koellikerstraße 2, in dem die Untersuchungsanstalt untergebracht war, wurde beim Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945 völlig zerstört. Es folgte eine Zeit der Notunterkunft im Bau 5 des Luitpoldkrankenhauses.
B. wurde 1947mit eben 29 Jahren kommissarisch Leiter der Untersuchungs-Anstalt, um dort 1946 zum Chemierat und schließlich 1953 zum Direktor ernannt zu werden. Bis zu seinem Tod 1975 war er Leiter der Anstalt, ab 1969 als Chemiedirektor und schließlich ab 1971 als Oberchemiedirektor. Seine Karriere wurde begünstigt durch die Tatsache, dass er weder in der NSDAP noch beim Militär war. Im Juni wurde ihm bescheinigt, dass er vom Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus nicht betroffen ist.
Unter seiner Leitung erfolgte zunächst 1951 der Umzug der Behörde in das Greiffenclau-Palais (Roter Bau) und die Teilverlegung der Anstalt 1959 in den Neubau in der Luitpoldstraße 1.
B. verantwortete zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen und erwarb sich dadurch in der Lebensmittel- und Weinchemie einen hervorragenden Ruf, nicht nur in Deutschland. Ebenso war er Mitherausgeber der neuen Auflage des Fachbuches „Weinchemie und Weinanalyse“. Berufungen in mehrere Gremien waren der sichtbare Ausdruck seiner Wertschätzung. So war er Mitglied der Weinanalysenkommission des Bundesgesundheitsamtes, des Forschungsrings des Deutschen Weinbaus bei der DLG und seit 1967 stellvertretender Vorsitzender des Bundesausschusses für Weinforschung. Das neue Deutsche Weingesetz von 1971 begleitete er mit seiner Expertise in der Entstehungsphase intensiv. International brachte er sich seit 1969 beim Internationalen Weinamt (OIV) als Mitglied in der „Unterkommission für Untersuchungsmethoden und Grundbestandteile des Weines“ ein.
Insgesamt spielte B. eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau und der Intensivierung der Lebensmittelüberwachung in Würzburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Biographie zieht sich durch die kritischen Jahre der Republik. Geboren in den Nachkriegswirren des 1. Weltkrieges erfolgten Ausbildung samt Promotion in den dramatischen Jahren des 2. Krieges. Sofort danach war er in der Aufbauarbeit beruflich stark gefordert, also in einer Zeit großer Umwälzungen, aber auch großer Möglichkeiten. Seine Fähigkeiten konnte er in dieser Phase gewinnbringend einsetzen. Leider waren ihm in der Konsolidierungsphase der Bundesrepublik Deutschland bis zu seinem Tod nur wenige Jahre vergönnt.
Bildquelle: Weinbau-Jahrbuch 1977
Jochen Hamatschek, Februar 2025