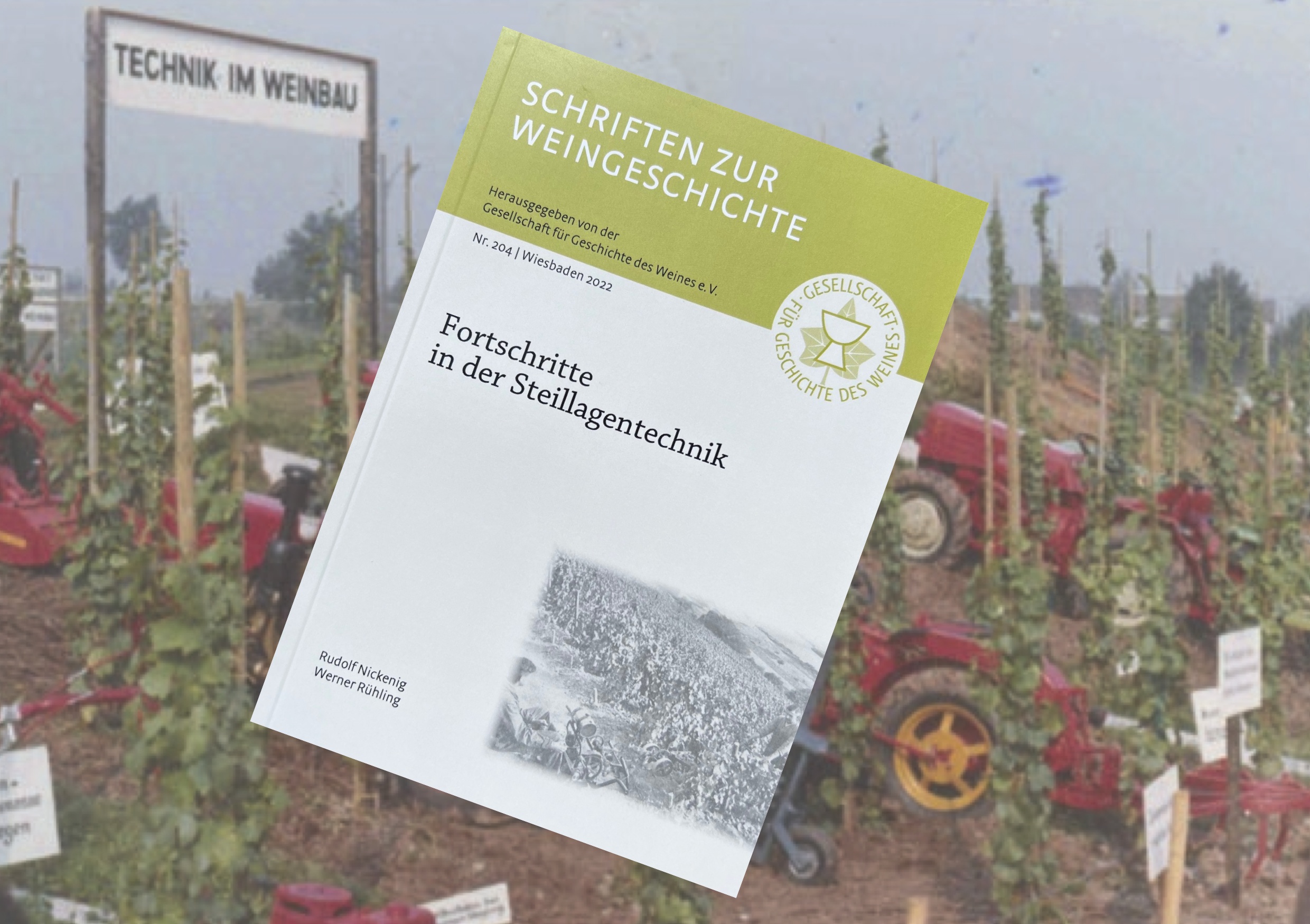Am 29. Dezember 2022 verstarb Dr. Reinhold Baumann, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat und Ehrenmitglied der GGW
Vortragsreihe im Landesmuseum Württemberg über die Geschichte von Bier und Wein – Die Vorträge wurden aufgezeichnet und sind nun als Video verfügbar!
Weiterlesen: Vortragsreihe in Stuttgart zur Sonderausstellung „Berauschend“
Prof. Dr. Michael Matheus erhält für seine herausragenden Leistungen und sein besonderes Engagement den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz
Weiterlesen: Prof. Dr. Michael Matheus mit Landesverdienstorden ausgezeichnet
Tradition und Kultur des Weinbaus in Rheinhessen als Buch und als Webseite
Neuer Vorlesungszyklus ab November 2022 an der Hochschule Geisenheim von und mit Dr. Daniel Deckers (FAZ/HGU)
Rudolf Nickenig/Werner Rühling: Fortschritte in der Steillagentechnik
Ein neuer Podcast aus der Serie "Aufgekreuzt" des Portals katholisch.de zur gemeinsamen Geschichte von Kirche und Wein
Die GGW führte im Oktober 2023 eine Tagung mit Schwerpunkt „Weingeschichte und Nationalsozialismus“ durch und überarbeitet ihre Veröffentlichungen.
Geschichte und Gegenwart des Weinbaus im niederösterreichischem Weinviertel und in den Nachbarregionen in Ostmittel- und Südosteuropa
Weiterlesen: Jahrestagung der GGW vom 25.-29. Mai 2022 in Retz – Nachlese
Mit Vorträgen zur Weingeschichte in Niederösterreich und in den Nachbarregionen in Tschechien, Rumänien und Ungarn. Das Symposium steht allen Interessierten offen. Anmeldung bis Mitte Mai möglich!
Weiterlesen: Öffentliches Symposium zur Weingeschichte am 27. Mai 2022 in Retz im Weinviertel